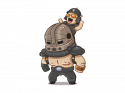- Deutscher Titel: The Wrestler
- Original-Titel: The Wrestler
- Regie: Darren Aronofsky
- Land: USA
- Jahr: 2008
- Darsteller:
Drehbuch: Robert D. Siegel
Darsteller: Mickey Rourke (Randy „The Ram“ Robinson), Marisa Tomei (Cassidy), Evan Rachel Wood (Stephanie), Mark Margolis (Lenny), Ernest Miller (The Ayatollah), Dylan Summers (The Necrobutcher), Tommy Farra (Tommy Rotten), Mike Miller (Lex Lethal), Todd Barry (Wayne) u.a.
Vorwort
Randy „The Ram“ Robinson hat seine Glanzzeiten weit hinter sich. In den 80ern gehörte er zu den Topstars des Pro-Wrestling und sein Kampf 1989 gegen den „Ayatollah“ gilt als einer der Klassiker des Sports. Heute lebt er in einem Trailerpark, trägt ein Hörgerät und überlebt so gerade eben von dem Geld, das er sich als Lagerist und bei Wochenendauftritten in kleineren Kämpfen verdient – bei weitem nicht genug, um für Miete, Essen und die Masse an Steroiden und Schmerzmitteln aufzukommen, die seinen Lebensweg prägen. Seine sozialen Kontakte beschränken sich auf die Stripperin „Cassidy“, seine Kollegen aus den Umkleiden und den Bookern, die ihm ein lukratives Angebot unterbreiten: Auf den Tag genau 20 Jahre nach seinem legendären Kampf gegen den „Ayatollah“ soll es das Rematch geben, im Rahmen einer Veranstaltung der Liga R.O.H…. doch dann erleidet Randy nach einem Hardcorematch einen Herzanfall…
Inhalt
Man sollte Sean Penn verprügeln, ihm den Oscar entreißen und ihm Mickey Rourke nachträglich zuschieben (und, wenn man dabei ist, Bill Murrays Oscar auch gleich zurückgeben). Auch wenn ich „Milk“ nicht gesehen habe, eine schauspielerische Leistung wie die des alten Kim-Basinger-Poppers Rourke sucht seinesgleichen, das muss man einfach und direkt sagen. Bewies der einstige Schönling schon in Sin City einen hochgradigen Mut zur Hässlichkeit, legt „the Wrestler“ eine gehörige Schaufel drauf, indem er die comichafte Überhöhung und die Stilisierung zum „Übermenschen“ beiseite schmeißt und den mittlerweile 56jährigen so zeigt, wie er ist: Botox- und steroidgefüllt und einer Haut, die durch jahrzehntelangen Sonnenstudiobesuchs mittlerweile aussieht wie eine alte, weggeworfene Aktentasche ((c) by Frank Zander). Aber genau das ist es, was Mickey Rourkes Darstellung des Randy Robinson so ausmacht: Eine schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst.
In dem Stile könnte man jetzt noch weitermachen, Rourkes Schauspielleistung (verdammt gut) über den grünen Klee loben, seine autobiographischen Verbindungen zu der Rolle hervorheben (zahlreich, immerhin war Rourke ja selbst einige Jahre lang Boxer) und seinen Einsatz richtiggehend zelebrieren. Rourke nahm z.B. echtes Wrestlingtraining bei der Legende Arthur „Afa“ Anoa’i (aus dessen weitläufigem Verwandten und Bekanntenkreis Namen wie Rikishi, Yokozuna, Batista oder The Rock hervorgingen, die auch einem Nicht-Wrestlingfan etwas sagen könnten), und ließ sich im Zuge des Hardcorematches mit einem Tacker bearbeiten, in Reißzwecken schmeißen und mit Stacheldraht verhauen. Und wenn er es nicht tat, dann sah es verdammt echt aus.
Ich denke aber, ihr habt verstanden, worauf ich hinaus will: Mickey Rourke als Randy Robinson, das ist Herzblut, Seelenstriptease, schonungslose Aufbereitung der eigenen Biographie und ehrliches Eingeständnis der eigenen Unvollkommenheit. Und diese Einstellung, die sich durch den gesamten Film zieht, wandelt „The Wrestler“ von einem durchschnittlichem Sportlerdrama zu einer kleinen Perle um. Denn die Geschichte des alten, verbrauchten Stars, dessen Leben in Scherben liegt und der es nochmal wissen will, ist wahrscheinlich so alt wie das Zelluloid selbst. Einzig das Sujet des Pro-Wrestlings bietet in diesem Zusammenhang eine Abwechslung zu den allseits bekannten Baseball- und American Footballfilmchen. Und das mag für Leute, die diesem Sport nicht viel abgewinnen können und deren Wissen bei der WWE (ehemals WWF) und Hulk Hogan beginnt und endet, auf den ersten Blick abschreckend wirken – wer möchte es ihnen verübeln.
„The Wrestler“ erschließt sich in seiner ganzen Pracht auch wirklich nur den Leuten, die den Wrestlingzirkus verfolgen bzw. ihn mal verfolgt haben, denn ebenso schonungslos, wie Mickey Rourke mit sich selbst umgeht, geht das Business mit sich selbst um: Das Kayfabe (die „Vereinbarung“ der Wrestler und der Fans, das, was im Ring an Feindschaften und Fehden geboten wird, als real zu akzeptieren) wird nicht nur gebrochen, sondern im Film gar nicht erst aufgebaut. Es wird von Beginn an keinen Hehl daraus gemacht, dass die Matches abgesprochen sind und zu einem Großteil aus Show bestehen. Dieser „Blick hinter die Kulissen“ ist auf jeden Fall sehenswert, in Gänze allerdings wohl nur dann zu genießen, wenn man das Bild, das dem Ottonormalzuschauer geboten wird, ebenfalls vor Augen hat.
Neben Mickey Rourke tummelt sich eine beachtliche Riege an Schauspielern vor der Kamera. Neben bekannteren und unbekannteren Gesichtern aus dem Wrestling-Business wie Nigel McGuiness oder Ron „The Truth“ Killings, die sich selbst darstellen, heben sich der „Necrobutcher“ (The Rams Gegner im Hardcorematch) und Ernest Miller als Ayatollah besonders hervor, die sichtlich Spaß daran haben, ihren Job und ihr Leben vor der Kamera zu präsentieren. Aus der Riege der „normalen“ Schauspieler sticht Marsia Tomei als abgehalfterte Stripperin Cassidy ganz besonders hervor, die ihrem Leben zwischen den Welten (alleinerziehende Mutter bei Tag, Ausziehpüppchen bei Nacht) mit Engagement und Spielfreude füllt und sich auch nicht scheut, im Zuge ihrer Auftritte auch mal blank zu ziehen (und das ist für eine knapp 44 jährige nicht nur mutig, sondern auch recht… ansehnlich). Evan Rachel Wood (u.a. Hauptdarstellering in Thirteen und Ex-Lebensgefährtin von Marylin Manson) hat als Randys Tochter Stephanie eine kleinere, aber eindrucksvolle und sehr wichtige Rolle und weiß diese auch zu füllen.
Unterstützt wurden die Arbeiten am Film übrigens nicht nur von einigen Wrestlern, sondern auch durch die Ligen selbst. Wenigstens WXW, ROH und CZW geben sich die große Ehre, in einigen Gazetten las man von Beteiligung der Dinosaurier der WWE, was man allerdings unter Gerüchte verbuchen kann, denn die alles überragende Liga wird weder im Film noch in den Credits mit keinem Wort erwähnt. Andeutungen darauf gibt es freilich reichlich: Der Madison Square Garden, in dem The Ram seinen historischen Sieg über den Ayatollah errag, ist der Austragungsort der ersten Wrestlemania, die Fehde der beiden Kontrahenten ist eindeutig von der Fehde Hulk Hogan gegen den Iron Sheik inspiriert und manches mehr. Unterstützung erfuhr das Projekt übrigens auch von anderen Seiten: Aufgrund des knappen Budgets überließ Axl Rose die Rechte an „Sweet Child Of Mine“, The Rams Eingangsmusik im finalen Kampf, für lau.
Der ganze Film ist ein einer Art Semi-Dokumentation. Großteile der Handlung werden mit Handkamera gefilmt, die Schnitte sind teilweise recht hart und unamerikanisch, wenn man so möchte. Allerdings niemals unangenehm oder unangemessen, wenn man sich nach ein paar Minuten auf den Stil eingelassen hat, hat man als Zuschauer wirklich das Gefühl, eine reale Geschichte zu erleben. Verfremdungen kommen selten vor, die Hollywood-Trickkiste bleibt meist geschlossen. Am eindrucksvollsten präsentiert diese Technik sich während der Wrestlingmatches selbst, denn der Zuschauer bleibt immer hart am Mann und betrachtet das Geschehen aus der Perspektive Randys. Es wird klar, dann Wrestling zwar bis zu einem gewissen Grad gespielt ist, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn man auf die Matte klatscht, dann tut es nun mal weh.
Der langen Rede kurzer Sinn: Bei „The Wrestler“ geht es nur zweitrangig um das „Was wird gezeigt“, denn das kennt man schon zu genüge. Das „Wie“ bestimmt die Qualität des Films, die direkte und brutal ehrliche Präsentationsweise, die Offenheit, die Spielfreude und der Mut der Darsteller (allen voran, man kann es nicht oft genug sagen, Mickey Rourke) und die erfrischend unverbrauchte Spielwiese „Pro-Wrestling“ machen den Film so ansehnlich, wie er ist. Für Wrestlingfans ein Muss, für Nicht-Fans ein „Sollte trotzdem“. Wenn man noch die Chance hat ihn im Kino abzugreifen, dann sollte man auch keine Sekunde zögern, denn hier wird gezeigt, dass man Intensität auf der großen Leinwand erzielen kann, ohne auf einen schmalzigen Soundtrack oder Computereffekte zu setzen. Genug Intensität übrigens, um gestandene Wrestler wie Rowdy Roddy Piper bei der Aufführung in Tränen ausbrechen zu lassen.
Ach ja: Und Sean Penn gehört immer noch verprügelt und seiner Oscars beraubt.
2009 Ascalon
Review verfasst am: 2009