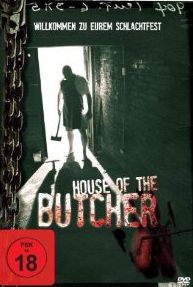
- Deutscher Titel: House of the Butcher
- Original-Titel: Butcher House
- Regie: Christopher Hutson
- Land: USA
- Jahr: 2006
- Darsteller:
Laila Dagher (Annie), Cooney Horvath (Tyler), Erin Fleming (Jamie), Erin Cowden (Karla), Peter Berube (Blake), Jay Costelo (Josh), Sherwood Scott (Butcher), Sean Galuszka (James Kingston, als Sean Will), Kimberly Rowe (Terry Kingston)
Vorwort
Ein paar Dollar zusätzliches Taschengeld kann jeder Teenie gebrauchen, so auch die Clique um Tyler, dessen Dad ein leerstehendes altes Schlachthaus erworben hat, um daraus einen Parkplatz o.ä. zu machen. Für 10 Dollar pro Stunde sollen Tyler und seine Freunde in der Hütte mal Inventur machen, den Strom einschalten, Glühbirnen reinschrauben u.ä. Normalerweise wäre das für jeden Teen von Welt die Ausrede, vor Ort allerlei Hallodri und Juche zu veranstalten, aber Tyler legt Wert darauf, dass tatsächlich gearbeitet wird. Als er allerdings versehentlich verrät, dass vor über vierzig Jahren ein Metzgermeister namens Sam Gaines Amok lief und diverse Kollegen, darunter auch den Sohn des Schlachthofbesitzers, brutalst meuchelte, ist’s mit der ernsthaften Arbeit natürlich vorbei – die Blase will den Tatort mit allen blutigen Details besichtigen. Und als Grufti-Girl Annie und der Iro-Träger Josh ein Fleischerbeil, bedeutungsschwanger in der Wand steckend und von aztekischen Symbolen und wenig kryptischen Warnungen umzingelt, finden, hat Josh natürlich nichts besseres zu tun, als das Mordwerkzeug aus der Wand zu puhlen und stolz den diversen Freunden vorzuführen.
Wie nicht anders zu erwarten eine ausgesprochen schlechte Idee, denn damit ist der böse dämonische Fleischermeister aus seinem spirituellen Gefängnis befreit und kann sich munter ans metzelnde Werk machen… Dieweil der Schlachter (erfreulicherweise in Reihenfolge der Nervigkeit) die Teens dezimiert, erwacht in James Kingston, dem jüngeren Bruder des seinerzeit verhackstückten Besitzersohns, die Erkenntnis, dass der Killer wieder am Werk ist und es seine (sprich James) heilige Pflicht ist, dieses blutrünstige Treiben zu beenden.
Inhalt
Hurra, endich wieder ein preiswerter Horrorfilm aus den Staaten. Gibt ja nur so wenige davon (ja, und ich Depp kauf sie ja auch alle oder komme, wie vorliegend, durch eine Kiste Rezi-DVDs dazu). Es mag komisch klingen, speziell aus der Tastatur eines Schreiberlings, den, gäbe es nicht Myriaden schlechter Horrorfilme, die nach Vernichtung brüllen, vermutlich kein Mensch lesen würde, aber es droht langsam wirklich der Zeitpunkt, an dem mich Horrorfilme aus Prinzip anöden. Neue Ideen gibt’s kaum, die alten Ideen werden bis zum Erbrechen durchgenudelt und dank der mittlerweile herrschenden Erschwinglichkeit von Video-Equipment, mit dem man ansatzweise filmähnliche Lichtspielwerke realisieren kann, meint mittlerweile sowieso jeder Knallfrosch, der mal von seinem großen Bruder gehört hat, wie rum man ’ne Kamera hält, er müsse seinen eigenen drehen. Toll.
Okay, rant over. „House of the Butcher“ (die deutsche Titelvariante ist ausnahmsweise mal tatsächlich eine Verbesserung zum Originaltitel) ist das Geisteskind von Christopher Hutson, einem ehemaligen stand-up-Komiker, der nach dem Versuch, als Schauspieler in Hollywood Fuß zu fassen (und als wohl bedeutendsten Gig einen Auftritt im Pilotfilm von „Akte X“ zu verzeichnen hat) und dabei nicht wirklich auf einen grünen Zweig kam, zur Erkenntnis kam, wohl als Regisseur bessere Karten zu haben, und mit einem gewissen William Langlois, der sich seine Sporen als Location Manager bei Jim Wynorski verdiente (what? Wynorski-Filme haben „Locations“? Der dreht doch auch normalerweise im nächstbesten Stadtpark und schneidet seine zugekaufte stock footage außenrum) und offenbar als Belobigung für geleistete Arbeit auch ein paar Scripts für Jimbo tippen durfte (u.a. „Sub Zero“), das Drehbuch verfaßte und es für schlanke 165.000 Dollar (IMDb-estimate) auch gleich verfilmte.
Da weiß man doch gleich, was man erwarten sollte, nämlich nicht viel bis gar nix. Dafür ist „House of the Butcher“ gar nicht *so* schlecht. Jupp, die Plotte ist natürlich mal wieder ausgesprochen originell – eine Handvoll Teenager, ein irrer Killer, eine isolierte Location, presto, instant slasher movie. Dass „House of the Butcher“ trotzdem einigermaßen leidlich halbwegs ein bisschen funktioniert, liegt primär an zwei Tatsachen – erstens ist die Location (vielleicht muss ich Meister Langlois gegenüber doch Abbitte leisten) eine amtliche Killer-Location, nämlich ein echtes leerstehendes altes Schlachthaus, und wirkt demgemäß überaus authentisch und creepy, zweitens erfindet das Script zwar das Rad nicht neu, hat aber ein-zwei Ideen, die es über ein übliches Slasher-Script von der Stange hinausheben. Der „Clou“ der Geschichte ist, dass das jeweils nächste Opfer des Killers „vorherbestimmt“ ist (das ist es zwar faktisch in den allermeisten Slashern, aber selten aus der Story hinaus begründet) und nur dieses nächste Opfer den Killer tatsächlich *sehen* kann (für die anderen Figuren sieht es so aus, als würde das Opfer von der blanken Luft gemeuchelt); darüber hinaus kann der Killer seine Opfer durch eine Art „Hypnoseblick“ „übernehmen“ und auf diese Weise mit anderen Charakteren interagieren. Keine supertolle Sache, aber zumindest genügend Eigenständigkeit, um sich vom bloßen „Freitag“-Klon-Feeling ein wenig zu emanzipieren.
Der Rest der Story ist dagegen vergleichsweise Standard – die Charaktere sind das übliche Assortment an mehr oder weniger (mehr weniger) intelligenten Jungnasen, das Script nimmt manchmal arg konstruierte Klimmzüge, um die Gruppe aufzuteilen, damit das nächste Opfer von der Herde separiert werden kann, die „Mythologie“ des Killers ist komplett konfus (der Killer ist zwar eindeutig Sam Gaines, der 60er-Jahre-Schlächter, aber da steht auch noch ein okkulter aztekischer Fluch dahinter, der nie wirklich erklärt wird), dito die „Auflösung“ (bis hin zum obligatorischen Kicker-Ende) und generell stört ein wenig die alles andere als flüssige Einarbeitung des James-Kingston-Subplots, der aber zwingend nötig ist, weil der Streifen sonsst nach 60 Minuten vorbei wäre, und das wollte ja auch keiner.
Von der optischen Seite schlägt sich Hutson unter den Möglichkeiten, die ihm das magere Budget so bieten, ganz wacker – Kameramann Bruce Ready, der seinen Job bei Reality-Shows wie „The Bachelor“ oder „The Simple Life“ gelernt hat, und der Regisseur versuchen aus der wie erwähnt eindrucksvollen Location ihren Nutzen zu ziehen. Atmosphärisch gibt’s daher wenig zu bemängeln, die Kameraarbeit selbst ist durchaus okay für die Verhältnisse eines Ultra-Low-Budget-Films und gelegentlich wird auch mit dem ein oder anderen Schnitt-Einfall ein bisschen Dynamik geschunden, aber trotzdem ist das a) noch immer eindeutiger Indie-/Videolook und b) heißt creepy-atmosphärisch noch nicht im Umkehrschluss „nice to look at“. Sicher, Horrorfilme haben nicht primär den Sinn, gut auszusehen, aber es darf manchmal schon etwas mehr sein als finstere, schmutzige Korridore. Ein bissl visueller Pep wäre hochwillkommen gewesen (die diversen Einblendungen des Kingston-Subplots und zu Taylors Vater reißen in der Hinsicht auch nicht viel). In den ersten zwei Filmdritteln gelingt es Hutson zumindest, das Tempo ziemlich hoch zu halten, es gibt wenig Vorlaufzeit, wir sind schon nach ein paar Minuten im Schlachthof und dann dauert’s auch nicht mehr lange, bis das Metzeln beginnt (zudem hat man uns mit einer Prologsequenz schon „eingestimmt“), allerdings geht Hutson eben nach einer guten Stunde der Plot aus, das Finale mit der eigentlichen Killer-Bekämpfung wirkt dann einigermaßen angetackert und entwickelt sich nicht schlüssig aus der vorhergehenden Geschichte.
Dafür aber ist „House of the Butcher“ eine ziemlich brutale Angelegenheit – Gliedmaßen werden abgehackt, Körper auf Fleischerhaken gesteckt, Gedärme extrahiert und in einer besonders sleazigen Sequenz, die mich schon fast an die fiesen Vertreter 70er-Jahre-Eurohorrors erinnert, tranchiert der Killer eins seiner weiblichen Opfer, nachdem er sie zuvor aus ihren Klamotten (zumindest die die oberen Körperregionen bedeckenden) gehypnosaftet hat. FX-technisch ist das alles ziemlich souverän gelöst, absolut unironisch inszeniert und schon reichlich hart. In der guten alten Zeit wäre der Hobel sicherlich ohne zweite Ansicht auf der 131er-Liste gelandet, selbst heute wundert’s mich noch beinahe, dass „House of the Butcher“ tatsächlich eine FSK-Freigabe bekam.
Der Score von Hutsons Stammkomponist Chris Kazmier ist okay, im Abspann gibt’s noch einen ganz netten Song der kanadischen Metalband Kill Rhythm.
Ein nicht wegzuredender Schwachpunkt des Streifens ist freilich sein Cast. Während ich durchaus goutiere, dass wir’s nicht mit dem üblichen attraktiv-hippen Jungmodelcast zu tun haben, mosere ich auch schon wieder rum, dass man deswegen ja nicht ausschließlich Hackfressen hätte casten müssen… man MUSS den Leuten ja 90 Minuten lang zusehen… Laila Dagher, die die Grufti-Goth-Rolle trotz übertriebener Tusche in der Visage einigermaßen plausibel bewältigt, ist reine Hutson-Stammkraft, der picklige Cooney Horvath feiert hier sein nicht sonderlich eindrucksvolles Langfilmdebüt und war seitdem in der Indie-Dramödie „Come Together“ zu sehen.
Erin Fleming („The Sarah Conner Chronicles“) hat die Freundlichkeit, sich halbnackt abschlachten zu lassen, deutet ansonsten aber keine größeren Ruhmestaten an und ihre Namensvetterin Erin Cowden (größte Glanzleistung: stand-in von Eliza Cuthbert in Captivity) tendiert mit fortschreitender Laufzeit stark dazu, mir auf den Senkel zu gehen. Das ist aber noch kein Vergleich zu Jay Costelo (Snakes on a Train), der offenbar einen persönlichen Rekordversuch unternahm, wie lange er vor einer Kamera dilettieren darf, bis ich meinen Fernseher mit der Axt zertrümmere (Antwort: keine fünf Minuten länger. Zum Glück ist er das erste Opfer).
Peter Berube (mittlerweile Co-Star des selbstgeschriebenen Mockumentarys „Thanks for Dying“) schlägt sich noch einigermaßen achtbar, Sean Galuszka ist körperlich anwesend, Sherwood Scott mimt den Butcher unter akzeptablen, if unkreativem FX-Make-up ohne hervorstechende Eigenheiten.
Bildqualität: Ganz lustig ist, dass Movie Power vor lauter Begeisterung über den durchaus gutklassigen anamorphen 1.85:1-Print (der vielleicht ein Fitzelchen mehr Kontrast hätte vertragen können und einen kleinen Mastering-Fehler, einen kurzen Störblitz, zu verzeichnen hat), vergessen hat, die FBI-Anti-Raubkopierer-Message wegzuhobeln… ansonsten geht das für einen kleinen Indie-Film durchaus okay.
Tonqualität: Mir war gestern mal nach deutschem Ton – ich bin ganz angetan, das ist sicher keine Super-Synchro auf Blockbuster-Niveau, aber die Sprecher geben sich redlich Mühe, wirken motiviert und scheinen auch die Sache mit der Betonung ganz gut im Griff zu haben. Dolby 5.1 und Dolby 2.0 wird geboten. Der englische O-Ton (2.0) wurde von mir nur kurz angetestet und laborierert ein wenig an der Indie-Krankheit, dass die Post-Production wohl Nachsynchronisation nicht als dringlichste Priorität einstufte.
Extras: Trailershow.
Fazit: Ich bin mir nicht sicher, ob „ich hatte schlimmeres befürchtet“ ein so großes Kompliment ist, aber das ist letztlich mein Wort zum Sonntag. Der Indie-Bereich bietet leider so viel Rotz, der allein durch seine Existenz den Zuschauer beleidigt, da sticht dann so’n Film wie „House of the Butcher“, der zumindest ein paar Sachen nicht ganz falsch macht und eineinhalb brauchbare Ideen hat, schon wieder positiv raus. Das spricht jedoch sicherlich mehr gegen das Genre als für den Film. Summa summarum wird der geneigte Fan, der keinen größeren Anspruch an seine Horror-Unterhaltung als ein paar blutige Kills, einigermaßen befriedigt sein. Mir persönlich ist’s noch eine Ecke zu wenig, aber man kann sich den Kram zumindest ankucken – das ist mehr, als man über so manch anderen Schotter (Dying God, ähm) sagen kann.
2/5
(c) 2010 Dr. Acula

