
- Deutscher Titel: Die Lümmel von der ersten Bank
- Original-Titel: Die Lümmel von der ersten Bank
- Alternative Titel: 1. Trimester: Zur Hölle mit den Paukern |
- Regie: Werner Jacobs
- Land: Deutschland
- Jahr: 1968
- Darsteller:
Hansi Kraus (Pepe Nietnagel), Uschi Glas (Marion Nietnagel), Theo Lingen (Dr. Gottlieb Taft), Günther Schramm (Dr. Kersten), Gila von Weitershausen (Helena Taft), Georg Thomalla (Kurt Nietnagel), Hannelore Elsner (Geneviève Ponelle), Rudolf Schündler (Prof. Dr. Arthur Knörz), Ruth Stephan (Dr. Mathilde Pollhagen), Balduin Baas (Dr. Blaumeier), Wega Jahnke (Lydia Meier), Hans Terofal (Pedell Bloch), Monika Dahlberg (Fräulein Wendt), Oliver Hassencamp (Dr. Priehl), Britt Lindberg (Susie Rixner), Ursula Grabley (Frau Taft), Ilse Petri (Frau Nietnagel) u.a.
Vorwort
Badmovies plant in einem Roundtable die Besprechung einer Serie, die wir bestimmt alle kennen – und ich habe die Ehre, den Anfang zu machen. Mal schauen, ob wir das durchziehen können oder schmählich scheitern wie bei dem letzten Versuch, das meisterhafte deutsche Lustspielkino mit einer Reihe von Reviews zu würdigen. Einige hatten ihren Beitrag geliefert (wir erinnern uns beispielhaft an den ersten „Heintje“-Teil, Rudi-Carrell-und-Ilja-Richter-Humor vom Feinsten und Verwechslungsulk mit Chris Roberts), andere versagten – darunter auch der Schreiber dieser Zeilen, der sich eigentlich „Klassenkeile – Pauker werden ist nicht schwer“ hätte vornehmen sollen, aber aufgrund akuter Belanglosigkeit schnell schon an den Notizen dafür scheiterte. Dies möchte ich ansatzweise mit diesem Review zu einem Film wiedergutmachen, der eigentlich ebenfalls auf der Liste der zu besprechenden Werke stand, aber nie reviewt wurde.
Und ich gehe mal – um es mit den berühmten Worten eines der größten Denker unserer Zeit, Dr. Gottlieb Taft, dem Oberstudiendirektor eines Gymnasiums in Baden-Baden, zu sagen – frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk und falle zum Einstieg gleich mit der Tür ins Haus: Man fasst es nicht. Man fasst nicht, dass die zwischen 1968 und 1972 produzierte „Lümmel“-Reihe das deutsche Publikum wie die Fliegen ins Kino scheuchte. Sieben abendfüllende Filme. In fünf Jahren. Das sind durchschnittlich erschreckende 1,4 „Lümmel“-Filme pro Jahr. Masse statt Klasse – man muss es so deutlich sagen. Die ersten vier Teile wurden mit der Goldenen Leinwand ausgezeichnet – ein Preis, der all jenen Filmen mit mindestens drei Millionen Kinozuschauern winkte. Ja, es waren verrückte Zeiten, will man vorschnell sagen, aber in einem Land, in dem ein Til Schweiger mit Gummischwänzen und vollgeschissenen Tüten über Jahre hinweg ein Millionenpublikum anziehen konnte, sollte man vielleicht doch ganz still sein.
Naja, und wenn ich ehrlich bin: Es ist ja nicht so, als hätte ich „Die Lümmel von der ersten Bank“ nicht selbst gern gesehen, als ich noch klein war. Die Reihe ist fester Bestandteil meiner Kindheitserinnerungen: Pepe Nietnagel und seine Freunde waren immer irgendwie da, nie dauerhaft, aber alle paar Wochen und Monate, als sie regelmäßig tagsüber durch ARD und Dritte Programme durchgereicht wurden wie billige Flittchen – bis in dieses immerhin auch schon über 20 Jahre alte Jahrtausend hinein. Erst im vergangenen Jahr zappte ich durch die Programme und sah Peter Alexander und Theo Lingen unabsichtliche Loopings im Flugzeug fliegen, weil da Schüler offenbar mal wieder ihren Paukern einen Streich gespielt haben, der in diesem Fall aber wohl nach hinten losging, denn seit wann spielten die Schüler ausgerechnet Stimmungskanone Peter Alexander so lebensgefährliche Streiche? Der war doch immer einer von den Guten. Meinte ich mich jedenfalls zu erinnern.
Doch was man früher als immerhin lustig genug empfand, dass man nicht sofort abschaltete, muss ja heute nicht mehr lustig sein. Und tatsächlich: Nach neuerlicher Sichtung aller sieben Teile mit dem nötigen Abstand stelle ich fest, was nicht wirklich eine Überraschung sein kann, erst recht, wenn wir uns zusätzlich an die zahlreichen Lustspiele der 50er, 60er und 70er aus Deutschland erinnern, nämlich dass die „Lümmel“-Reihe vor allem eines ist: entsetzlich altbacken. Nun könnte man dem entgegenhalten, dass das zur Entstehungszeit noch gar nicht auffallen konnte, aber das ändert nun mal nichts daran, dass es heute, rund 50 Jahre später, umso mehr auffällt. Und ich möchte einfach mal behaupten: Viele Witze waren damals schon ein so alter Hut, dass man ihn lieber gestern als heute in die Altkleidersammlung hätte stecken sollen.
Doch wem haben wir dieses zweifelhafte Vergnügen eigentlich zu verdanken? Der erste Teil „Die Lümmel von der ersten Bank“ basiert auf dem Roman „Zur Hölle mit den Paukern“ des 2018 verstorbenen Deutsch- und Englischlehrers Herbert Rösler (erschienen unter dem Pseudonym Alexander Wolf), der aus Sicht des Schülers Pepe Nietnagel einen satirischen Blick auf das deutsche Bildungswesen wirft. Franz Seitz, der zu dem Zeitpunkt schon vier Teile der „Lausbubengeschichten“ mit Hansi Kraus in der Hauptrolle produziert hatte (1969 kam noch die Clip-Show „Ludwig auf Freiersfüßen“ hinzu), wurde auf den Bestseller aufmerksam und strebte nicht nur eine Verfilmung an, sondern bei Erfolg gleich eine ganze Reihe weiterer „Lümmel“-Filme, weshalb er unter anderem auch das Recht erwarb, die Charaktere in neuen Filmstoffen wiederverwerten zu können. Und so ward eben „Die Lümmel von der ersten Bank“ geboren. Die satirischen Elemente wurden dabei fast vollends getilgt, um ein breiteres Publikum anzusprechen, und geblieben ist lediglich der klamaukige Generationenkonflikt zwischen in der Vergangenheit feststeckenden Lehrern und aufmüpfigen Schülern, die ständig Chaos anrichten, um sich vor essenziell wichtigen Dingen wie Klassenarbeiten, für die sie mal wieder nicht gelernt haben, zu drücken.
Für den ersten Teil nahm Werner Jacobs auf dem Regiestuhl Platz, der für Produzent Seitz die ersten drei Fortsetzungen der „Lausbubengeschichten“ drehte und auch schon Freddy Quinn in „Freddy und das Lied der Südsee“ einen eigenen Film schenkte – zweifelsohne mit seinen 59 Jahren ein Routinier in seinem Fach der anspruchslosen Unterhaltung, und mehr wurde ja auch gar nicht von ihm erwartet, weder ein professioneller Einblick in den Schulalltag noch eine Auseinandersetzung mit den Sorgen und Nöten der jungen Generation, von Verständnis dafür ganz zu schweigen.
Inhalt
Aber gehen wir mal in medias res. Leider hielt man es für eine gute Idee, über den Vorspann einen Schlager laufen zu lassen – gesungen vom Medium-Terzett, einer deutschen Musikgruppe aus Osnabrück, denen wir Lieder wie „Ein Loch ist im Eimer“ und „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ verdanken. Weniger bekannt dürfte dieser Liedtext sein:
„Wer lernt, der hat viel mehr vom Leben,
doch eines kann kein Buch uns geben,
das Gefühl, wir sind verliebt.
Es gibt schon vieles, das wir wissen,
doch unser Lieblingsfach ist Küssen,
weil es nichts Schön’res gibt.
[Refrain]
Sechs mal sechs ist sechsunddreißig,
sagt der Lehrer und ist fleißig,
wir sagen Sex mal Sex und denken Liebe,
weil sie uns so gefällt.
Wir lernen Caesar und die Griechen,
ich kann die Kerle all‘ nicht riechen,
denn viel schöner wär’s zu zweit.
Studieren, Musen und Ruinen,
doch steile Zähne, Duft und Bienen,
die sind leider nicht dabei.
[Refrain]
Die Alten halten nichts von Mode,
nur von Erfahrung und von Methode,
wir sagen, junge Leute brauchen Liebe,
denn sie ist alt wie uns’re Welt.“
Gut, darauf hätte man dann doch gut verzichten können, aber wenigstens ist das Lied auch schnell wieder vorbei (zwei Minuten können allerdings lang werden). Problematischer ist doch vielmehr eine Sache, die sich nicht so schnell überstehen lässt, weil sie ausnahmslos jeden Film der Reihe betrifft – und das ist die Besetzung des Pepe Nietnagel mit Hansi Kraus. Dieser löste nach einer Woche Dreharbeiten den überforderten Florian Lindinger ab, Sohn des österreichischen Schauspielers Hugo Lindinger (der wiederum später im sechsten Teil „Morgen fällt die Schule aus“ eine kleine Rolle annehmen sollte). Schon in den ersten Minuten von „Die Lümmel von der ersten Bank“ fragt man sich unweigerlich, was Lindinger denn so viel schlechter gemacht haben kann als sein Ersatz (hoffen wir mal, er konnte sich wenigstens nur seinen Text nicht merken), denn das, was Kraus – immerhin zuvor schon viermal Hauptfigur der „Lausbubengeschichten“-Reihe – anbietet, ist mit einem Wort: erschütternd. Außer einen fetten bayerischen Dialekt spazieren zu tragen (als ob das nicht schlimm genug wäre), bringt er nichts zustande und brettert mit einer bemerkenswerten Hölzernheit durch die Story, was umso fataler ist, weil er dem Drehbuch nach das sein soll, was man einen schlagfertigen Schüler nennt, der die lustigen Sprüche im Dutzend billiger raushaut und sich gerade deshalb großer Beliebtheit bei seinen Klassenkameraden erfreut. Nur ist nichts daran schlagfertig. Endlos bemüht verhaut Kraus mit seiner langsamen leiernden Tonlage, die Schlagfertigkeit schon gar nicht zulässt, auch die einfachsten Pointen und sieht gegen seine erfahrenen Schauspielkollegen älter aus, als die es sind – und das wohlgemerkt vom ersten bis zum letzten Teil der Reihe.
Darüber hinaus kann Pepe sich zu keinem Zeitpunkt zum Sympathieträger entwickeln. Im Gegenteil: Wenn die Lehrerschaft ihm einmal mehr die Hammelbeine langziehen will, hat er das verdammt noch mal auch verdient, allerdings nicht nur vonseiten der Pauker, sondern auch von seinen Mitschülern. Ständig bürstet er deren hinterfragende Zwischenbemerkungen, wenn er etwa mal wieder einen Streich ausgeheckt hat, unwirsch ab, weil er die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Von jedem seiner noch so debilen Pläne ist er überzeugt, und wenn doch mal was schiefgeht dabei, dann will er es nicht so gemeint haben. Mädchen und Frauen bezeichnet er abfällig als „Weiber“ (wörtlich über seine Schwester Marion: „Scheiß Weiber! Die lernen das Autofahren nie!“) und zeigt ihnen oft seine Geringschätzung, und der fortwährend respektlose Umgang mit seinem in diesem Teil sehr tölpelhaften Vater („So sind die Alten. Immer gleich beleidigt.“), der zwar Backpfeifen androht, sie dann aber leider doch nicht verteilt, soll uns augenscheinlich auf seine Seite ziehen, aber spätestens dann, wenn er ihn das dritte Mal mit seinem Vornamen Kurt anredet und wieder einen dummen Spruch über dessen Gewicht ablässt, möchte man ihm ernsthaft wehtun. Keine Ahnung, was Franz Seitz, der nicht nur dieses Drehbuch unter dem Pseudonym Georg Laforet schrieb, unter sympathisch-schlagfertigen Figuren versteht – sein Pepe Nietnagel (der sogar auf dem Schulklo raucht – was für ein Rebell!) ist es garantiert nicht. Nur leider hat Pepe im Rahmen der Serie Narrenfreiheit, weil sein Papa als Briefmarkenverkäufer viel Geld auf der hohen Kante hat, sodass er auch fetzige (naja) Hauspartys mit einer Band rund um Jürgen Drews (in einer ungenannten Gastrolle) als Beatles-Imitatoren feiern kann und überdies immer vorn mit dabei ist, wenn es um eine großzügige Schulspende geht, und schafft vermutlich nicht zuletzt deshalb trotz schlechter Leistungen regelmäßig die Versetzung in die nächste Klasse, auch wenn der Verdacht naheliegt, dass er auf seinem Weg von der 10a in diesem Film (1968) in die 13a im letzten Film (1972) einmal sitzen geblieben sein könnte. Schließlich liegen vier Jahre dazwischen.
Nun könnte man einwerfen, dass ich mich vielleicht mit großen Schritten auf ein Alter zubewege, in dem ich griesgrämig im Feinrippunterhemd Kinder von meinem Rasen brülle, die versehentlich einen Fußball auf mein Grundstück geschossen haben, weil Pepe mit seiner Art ja offenbar 1968 beim jungen Publikum ankam. Warum sonst sind wohl fast sechs Millionen Zuschauer in den Film gelaufen? Dann erinnere ich mich aber daran, dass ich Pepe schon als Kind eher doof fand. Der eigentliche Grund, warum ich immer wieder hängen blieb, waren für mich – klar! – die Streiche. Alles andere hat mich nie interessiert. Und ich hoffe – das hoffe ich wirklich inständig –, dass das auch für den Rest des Publikums der Grund war und nicht etwa, weil es wie Arschloch-Pepe sein wollte.
Besonders ein Schulstreich hat sich mir von Kindesbeinen an eingeprägt – und wie ich bei erneuter Sichtung feststellen sollte, war es auch gleich der erste Streich der Reihe überhaupt. Gut, streng genommen ist es der zweite, der allererste findet nämlich außerhalb der Schule statt, und der geht so: Als sich Pepe gleich zu Beginn des Films mit seiner älteren Schwester Marion auf den Weg zur Schule macht, fährt vor ihrem Wagen kein junges Mädchen, von dem sie wissen möchten, was es gerade denkt, sondern ein alter Sack. Der alte Sack ist Lateinlehrer Knörz, und er fährt auch nicht Wagen, sondern Fahrrad. Pepe animiert Marion dazu, ganz dicht aufzufahren, Pepe drückt auf die Hupe – und Knörz verliert daraufhin vor Schreck fast das Gleichgewicht. Und als die beiden an ihm vorbeifahren, weht ihm auch noch der Hut vom Kopf! Hey, hat da etwa jemand geschmunzelt?
Überhaupt Knörz: Der arme Kerl war schon immer der aus der Lehrerbande, mit dem ich am meisten Mitleid hatte. Knörz ist ein einziges Nervenbündel, beim Unterrichten immer unglücklich, immer überfordert, immer hysterisch. Pepe und seine Mitschüler nennen ihn verniedlicht „Knörzerich“ und spielen ihm stets die gemeinsten Streiche, die darauf abzielen, sein angeschlagenes Nervenkostüm nur noch mehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Dazu gehört auch der folgende Streich – eben jener im vorigen Absatz angesprochene, der sich mir frühzeitig eingebrannt hat. Dabei täuscht Pepe seinen Selbstmord vor, indem er eine wie er gekleidete Schaufensterpuppe auf dem Schulhof drapiert und einen Sprung aus dem mehrstöckigen Schulgebäude simuliert, sich in Wirklichkeit aber über einen Fahnenmast durch ein offenstehendes Fenster in ein ein Stockwerk tieferes Zimmer hangelt (nicht ungefährlich!). Auslöser für den vermeintlichen Selbstmord ist Knörz‘ Aufforderung an Pepe, sofort den Klassenraum zu verlassen, weil der einen Witz machte, der symptomatisch für die Qualität des gesamten Films, ach was, der gesamten Reihe ist:
Lehrer Knörz: ‚tegar‘. Was heißt das? Na, Meier?
Schülerin Meier: ‚Ich möchte gedeckt werden.‘
Lehrer Knörz: Wie kommst du denn darauf?
Schüler Pepe: Vielleicht hat sie es in einem Gestüt gesehen, und eine Stute hat das gesagt.
Von Hansi Kraus vorgetragen in seinem leiernd-monotonen Tonfall, als hätte er von richtiger Betonung noch nie was gehört.
Wegen dieses frechen Spruchs flippt Knörz aus (vielleicht fühlte sich auch Rudolf Schündler in seiner Schauspielehre gekränkt und machte Hansi Kraus für sein mieses Schauspiel zur Sau – eine Lesart, die mir am besten gefällt), und Pepe nimmt das wie gesagt zum Anlass, angeblich von den Worten tödlich getroffen aus dem Fenster zu springen. Der verstörte Knörz sieht den zerschmetterten „Pepe“ am Boden, eilt aus dem Klassenraum und ruft die Polizei. Da Direktor Taft anwesend ist, als er das tut, folgt der ihm auf den Schulhof, wo kein toter Pepe liegt. Dafür sitzt im Klassenraum ein quicklebendiger Pepe, und alle Schüler tun so, als wäre der Fenstersprung lediglich der Fantasie des überspannten Knörz entsprungen. An seinem Verstand zweifelnd weist sich der Lateinlehrer selbst ins Sanatorium ein. Und Pepes Klasse lässt es geschehen und freut sich bereits auf den Ersatz, den sie herausekeln kann.
Zu Pepes Pech ist der Ersatz Dr. Kersten, ein Lehrer unter 40, dessen hervorstechendstes Merkmal ist, von der gesamten Frauenwelt – Lehrerinnen, Studentinnen, ja sogar Mitschülerinnen von Pepe – angehimmelt zu werden. Doch Pepe wäre nicht Pepe, wenn er es noch in Unkenntnis des Neulings nicht trotzdem mit einem Begrüßungsstreich versuchen würde: Die reichlich dämliche Bekannte eines Klassenkameraden (was man schon daran erkennt, dass sie lispelt), eine sogenannte „Zische“ (kennt ihr nicht? Ich auch nicht; das ist nach Verständnis des Drehbuchautoren Jugendslang, den nicht mal der Duden kennt, und steht für „dummer, aber heißer Feger“ oder irgendwas in der Richtung), wird, obwohl eigentlich Verkäuferin in einer Boutique, als Schülerin engagiert, um sich bei jeder Gelegenheit zu melden, ihre Reize zu betonen und Kersten zu fragen, ob sie die Pille nehmen soll, „weil die Mitschüler so frech sind“ (O-Ton Pepe) – all das mit dem Ziel, den Pauker aus dem Konzept zu bringen. Ein wahrhaft großer Plan eines einzigartigen Genies. Nur leider ist Kersten nicht nur lecker. Er ist auch alles andere als blöd. Die lächerliche Scharade (die ich selbst nicht wirklich verstanden habe) durchschaut er praktisch vom Start weg, spielt sie aber eine Zeit lang mit, um die Schüler später aufzufordern, sich neue Streiche auszudenken (und bitte bessere, Anm. d. Red.). Kersten 1, Pepe 0. Ha!
Die Figur des Dr. Kersten sollte nicht das einzige Beispiel aus der „Lümmel“-Reihe für einen Lehrer bleiben, der die so ungehorsame Klasse mit Progressivität in den Griff bekommt und auf seine Seite zieht. Gut, in diesem Film erarbeitet sich der neue Lehrer den Respekt der Schüler eigentlich nur deshalb, weil er a) gut aussieht und b) so klug ist, nicht auf den denkbar bekloppten Versuch eines Streichs hereinzufallen. Das reicht, um von diesem Moment an bis zum Filmende für seine Klasse der coole Neue zu sein, den man unbedingt an der Schule behalten muss.
Beliebte Pauker können für den Rest der Lehrerschaft natürlich nur ein Dorn im Auge sein, vor allem wenn es eine solche Lehrerschaft wie am Mommsen-Gymnasium ist. Wer kennt sie nicht? Knörz ist ja nun weg, aber ein paar besonders verstaubte Exemplare sind geblieben.
Als da wären:
• Schuldirektor Taft, sehr konservativ und altmodisch: „er pennt sogar in der Penne, äh, ich mein‘, er wohnt sogar in der Penne“ (O-Ton Pepe – soll am Ende keiner sagen, ich würde zu wenig der Wortwitze zitieren)
• Oberstudienrat Priehl, Fächer: Erdkunde und Geschichte. Pepe bezeichnet ihn gleich zu Beginn, als er den Kinozuschauern neben Taft auch die einzelnen Lehrer vorstellt, als typischen Militaristen und mag damit recht haben, weil der im Unterricht Schoten wie „Der Deutsche sucht eher den Tod, als dass er seine Ehre preisgibt“ zum Besten gibt. Da der Pauker aber eh keine fünf Minuten Screentime hat und nicht einmal einen eigenen Streich gespielt bekommt, können wir den eigentlich komplett vergessen.
• Frau Dr. Pollhagen, Fächer: Biologie und Neue Sprachen. Ihre besondere Fähigkeit ist es, den Schülern ihr Spezialgebiet, die Befruchtung in der Pflanzen- und Tierwelt, beizubringen („Ist der Samen gut, kann der Rettich niemals pelzig schmecken, und sei er noch so alt“), wenn sie nicht gerade mit ihrer Sextanerblase dringend aufs Klo muss. Die wird ihr bei einem Streich auch zum Verhängnis, als die Schüler die Toilettentüren mit den Schildern „evangelisch“ und „katholisch“ versehen und die Arme entweder vor der falschen Tür steht oder eine Puppe oder gar ein Schüler die Toilette belegt. Ein Streich, der auch deshalb so lustig ist, weil die Filmgeschwindigkeit in bester Stummfilm-Slapstick-Manier hochgespeedet wird, während sie hektisch die Treppen hoch und wieder runter hastet. Überhaupt ist sie ein beliebtes Opfer: An anderer Stelle klemmt Pepe der vor ihm stehenden Pollhagen unbemerkt ihr Oberteil in den Reißverschluss seiner Strickjacke, sodass es zerreißt, als sie auf die Bühne gehen will, um zu dirigieren.
• Oberstudienrat Blaumeier, Fächer: Mathe und Physik. Der ist ehrenamtlicher Spickzettelbluthund, der auch mal unmittelbar vor Klassenarbeiten mit seinem Kopf einen Überraschungsangriff unter den Schülertisch startet, sich dabei aber auch durchaus in die Nesseln setzen kann. So zieht er vor einer Mathearbeit der Schülerin Meier einen vermeintlichen meterlangen Spickzettel aus dem Ausschnitt, nur um am Ende „SIE MÜSSEN AUCH JEDEN DRECK SEHEN“ lesen zu müssen. Obendrein ist er hier ein Meister der unbeabsichtigten Zweideutigkeiten („Steigt das konstante Glied, rutscht auch das Extremum nach oben“ – „Alleine schaffe ich das auch nicht bei allen, aber Müller von der Oberprima gibt unentgeltlich Nachhilfeunterricht, weil er es sehr gut kann und sonst auch nicht weiß, was er tun soll; der macht es dir sicher“). Weltkriegserprobt ist er auch, denn er kann täuschend echt die Unterschiede in den Tönen einer Luftschutzsirene bei Alarm und Probealarm stimmlich imitieren und macht das auch bereitwillig, wenn er von den Schülern danach gefragt wird. Außerdem weiß er zu berichten, dass Simulanten wie Pepe, der bei einer Mathearbeit fehlt, im Krieg hingerichtet worden wären. (Es war nicht alles schlecht.)
Andere Pauker sollen in diesem Film keine Rolle spielen, aber die Gestalten reichen ja auch völlig aus. Eine Erwähnung wert ist allerdings Pedell Bloch als Assistenz von Direktor Taft, den Schauspieler Hans Terofal, der Bruder des Produzenten und Autoren Seitz, von der ersten Sekunde in Teil 1 bis zur letzten Sekunde in Teil 7 mit Gummigesicht, überhektischer Gestik und unnachahmlich kurzatmiger Sprechweise derart hysterisch anlegt, dass er selbst in diesem lauten Krawall-Klamauk noch heraussticht.
So ist er auch fast immer mitten im Geschehen, wenn Pepe und seine Klassenkameraden außerhalb ihres Klassenraums ordentlich Rabatz machen und den gesamten Schulbetrieb lahmlegen. So gelingt es Pepe mit List und Tücke, die Lautsprecheranlage im Klassenraum anzuzapfen und von einer Toilettenkabine aus mit täuschend echter Taft-Stimme (Hansi Kraus bewegt die Lippen, Theo Lingen vertont) eine Gedenkfeier anzukündigen, die zum einen die aktuell zu schreibende Mathearbeit dankenswerterweise unterbricht und zum anderen auch alle anderen Klassen in der Schulaula versammelt, denn wer möchte schon Unterricht machen, wenn es Wichtigeres wie eine Gedenkfeier gibt? Das wäre ja pietätlos! Als sich das bis zu Taft herumspricht, hat der natürlich keine Ahnung, was für eine Gedenkfeier das sein soll. Allerdings schiebt er das eher darauf, dass er zu viel im Kopf hat und spielt das Spiel tapfer auch dann noch mit, als er längst am Pult in der Aula steht und eine Rede halten muss. Bloch kapiert als Erstes so richtig, dass hier was nicht stimmen kann und raunt Taft in dessen ausschmückenden Schwafelrede das Wort „Missverständnis“ zu, was wiederum Taft missdeutet und kurzerhand den „Tag des Missverständnisses“ ausruft. (Es sei an dieser Stelle zugegeben, dass Tafts inhaltsleeres Geschwallere, um wertvolle Zeit zu gewinnen und nicht zugeben zu müssen, nicht zu wissen, was hier überhaupt gespielt wird, durchaus für den einen oder anderen echten Schmunzler gut ist.)
Später bringt sich Bloch mit Helm und Trillerpfeife ein, als die bereits angesprochene Luftschutzsirene zum Einsatz kommt, nachdem Taft ausgerechnet Pepe angeleitet hatte, den vierköpfigen Zivilschutzausschuss in Empfang zu nehmen, der den schuleigenen Schutzraum auf seine Sicherheit prüfen will. Schwerer Fehler. Natürlich kann der Lausebengel sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, und er sperrt die Dame und die Herren im stockfinsteren Schutzraum ein („Nehmen Sie die Finger aus meiner Bluse, Sie Ferkel“), um daraufhin mittels Hebel abwechselnd Alarm und Entwarnung zu geben, was zur Folge hat, dass Schüler- und Lehrerschaft wild durch die Klassenflure purzeln und hin und her gehetzt werden, bis sie schließlich alle in den Keller zu jenem abgeschlossenen Schutzraum türmen. Es entbrennt allgemeines Gerangel um den Hebel, der mal auf Alarm und mal auf Entwarnung steht, Feuerlöscher werden von den Wänden gerissen und mit deren Inhalt wild durch die Gegend gespritzt. Auch Bloch wird getroffen, der vergeblich versucht, der hektischen Lage Herr zu werden. Wie man sich denken kann, funktioniert der Witz besser als Monty Pythons „tödlichster Witz der Welt“. Pepe hat indes keine Konsequenzen zu befürchten, obwohl er diesmal ja nachweislich was angerichtet hat.
So weit die Scherze mit dem bedauernswerten Lehrerkollegium während der Schulzeit. Ich schrieb ja nun aber oben, dass beliebte Lehrer von ihren Kollegen in der „Lümmel“-Reihe stets mit Argwohn beobachtet werden. Das ist bei Kersten nicht anders, wobei es hier eigentlich ausschließlich Direktor Taft ist, der ein großes Problem mit ihm hat. Die Pollhagen beispielsweise findet ihn nämlich echt dufte und himmelt ihn an (weil jung und attraktiv und so). Bereits am ersten Schultag zieht Kersten Tafts Aufmerksamkeit auf sich, als er nach dem misslungenen Streich der Schülerschaft die dumme Boutiquenverkäuferin, ganz Kavalier, mitten in einer Unterrichtsstunde nach draußen begleitet und dabei mit einem Griff an ihren Arm auf Tuchfühlung geht. Das mag Taft nicht wirklich gutheißen, aber er könnte vermutlich noch damit leben. Da sich allerdings seine eigene Tochter Helena in den Schönling verguckt und der sich auch noch in sie, ist er als besorgter Vater, der keine anderen Männer im Leben seines schutzbedürftigen Kindes duldet, ziemlich eingeschnappt. Zum großen Teil ist der Unmut aber von Kersten auch selbstverschuldet, denn auch mir fiel er gleich negativ auf, da er schon beim ersten Aufeinandertreffen heftig an Helena herumbaggert, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass sie nicht mehr zur Schule geht und Romanistik-Studentin ist. Progressivität bedeutet eben auch, als Pauker den Flirt mit möglicherweise minderjährigen Schutzbefohlenen zu suchen. Beim gemeinsamen Tennisspielen kommen sie sich näher, und ich für mich kann sagen: Diese elenden Love-Stories in Pauker-Komödien fressen reichlich Zeit und haben mich schon immer mehr genervt als alles andere.
(Dazu gehört übrigens auch die elend unwitzige Episode rund um die französische Austauschschülerin Geneviève, die Familie Nietnagel als Gastfamilie bei sich aufnimmt. Darin kommt zwar nicht direkt eine Liebesgeschichte vor, aber wie sich der verheiratete Papa Kurt für die junge Frau in Schale wirft und ihr unbeholfen zu imponieren versucht, macht ihn nicht nur zu einem geilen alten Bock, sondern schlägt auch viel Zeit und Geduld tot. Immerhin wird Geneviève von einer atemberaubend heißen Hannelore Elsner verkörpert, die hier nicht ihren letzten Auftritt in der Reihe haben soll.)
Wie dem auch sei: Nach ein paar privaten Tennisstunden und einem gemeinsamen Abendessen kommt es zwischen Helena und Kersten zum ersten Kuss, leider unmittelbar vor dem Anwesen der Familie Taft und leider unmittelbar in dem Moment, als Helenas Vater mit seiner Frau vom abendlichen Spaziergang heimkommt. Das ist gleich doppelt bitter. Taft flippt entsprechend aus, weil es ja nun mal nicht sein kann, dass irgendein dahergelaufener Lehrer-Hallodri seine Tochter mit der Zunge nahezu entjungfert und sie zum Spielball seiner Leidenschaften macht. Damit mag Kersten zwar noch keine Straftat begangen haben, aber er ist bei Taft gewaltig unten durch.
Helena wendet sich in ihrem Schmerz an Pepes Schwester Marion, und da auch sie der Meinung ist, dass der Kersten so ein toller Mensch ist (wie gesagt: er sieht halt gut aus, das reicht aus, um ein toller Mensch zu sein), bittet sie Pepe um Hilfe. Der hat sich bisher zwar maximal in äußerst eingeschränktem Umfang um Deeskalationen verdient gemacht, aber Ideen, die hat er ja irgendwie immer. In der Hinsicht läuft er zur absoluten Höchstform auf und diskutiert mit Marion diverse Möglichkeiten.
Was ist, wenn Kersten Helena entführt? – Na Quatsch, wir sind doch nicht im Mittelalter!
Hm, aber was ist, wenn sie heimlich in Las Vegas heiraten? – Pah, Helena hat doch keine Papiere!
Moment mal, jetzt hat er’s: Was ist, wenn er in der Zeitung eine Verlobungsanzeige im Namen von Direktor Taft für Helena und Dr. Kersten aufgibt? – So machen wir’s!
… … … Ja. Was soll ich sagen? … … … … Ja. Die naheliegendste Lösung. Eindeutig.
Die Folge: Taft stellt Kersten wutschnaubend zur Rede, weil er vermutet, der Lehrer stecke hinter der ganzen Sache und wolle ihn erpressen – und suspendiert ihn. Toll gemacht. Wer hätte das auch kommen sehen können? Pepe bestimmt nicht. Kleinlaut jammert er: „Ich hab’s nur gut gemeint.“ Das glaube ich ihm sogar. Er wusste es halt nicht besser.
Dafür kommt er gleich mit einer neuen Idee um die Ecke, wie man Kersten retten könne.
Was? Ihr habt auch eine Idee? Wie bitte? Das Missverständnis aufklären und reinen Tisch machen, wer wirklich hinter der Anzeige steckte? Aber hallo – genauso hätte ich es gemacht, aber ich bin ja nicht Lausbub. Pepe weiß was Besseres: Man blamiert Taft so sehr, dass er die Suspendierung einfach rückgängig machen muss!
Hä?
Aber schimpfen wir nicht vorschnell. Wer mit Pepes Einfall erst einmal nichts anfangen kann, wird sein Urteil sicherlich umgehend revidieren, wenn ich den Plan, wie er in die Tat umgesetzt wird, in allen Einzelheiten vor euch ausbreite. Er ist in der Tat so kunstvoll und verzwickt, dass ihn auch „Tenet“-Versteher nicht auf Anhieb verstehen werden. Also:
1. Man nehme Geld aus der Klassenkasse, mit dem man ein Fremdenzimmer in einer Pension buche.
2. Man bringe in dem Zimmer Geneviève unter und weihe sie in den Plan ein.
3. Man stelle zwei Paar Schuhe vor das Zimmer: Herrenschuhe und pinke Schuhe von Helena, die ihr Vater in einer früheren Szene bereits als unzulässiges Papageien-Outfit für seine Tochter bezeichnet hatte.
4. Man lade Dr. Kersten in die Pension zum Abendessen ein und weihe ihn in den Plan ein.
5. Pepes Schulklasse treffe sich mit Dr. Kersten in der Pension.
6. Marion fahre mit Helena unter einem Vorwand weg und täusche eine Autopanne vor, damit Helena nicht zu früh nach Hause kommt.
7. Man versende ein anonymes Telegramm an Taft mit folgendem Inhalt: „Wenn Sie wissen wollen, wo Ihre Tochter die Nacht verbringt – im Gasthof Nachtigall in Neuweiher, Zimmer 7. Ein Freund.“
8. Taft werde wutentbrannt ein Taxi nehmen und zur Pension fahren.
9. Sobald er ankommt, schalte der Sohn des Besitzers der Pension kurz das Licht über den Sicherungskasten aus: das Zeichen für Geneviève!
10. Taft werde zu Zimmer 7 laufen, die pinken Schuhe seiner Tochter mitsamt den Herrenschuhe davorstehen sehen und Helena in den Armen von Dr. Kersten vermuten.
11. Taft werde das Zimmer stürmen.
12. Geneviève werde in Unterwäsche wegen dieses Wüstlings um Hilfe schreien und Kersten in die Arme fallen.
13. Taft wäre blamiert.
… … … Äh.
Grübel, grübel, grübel.
Ich möchte ja nicht meckern, aber dafür, dass hier über Minuten hinweg so viel Aufwand betrieben wurde, ergibt das alles verblüffend wenig Sinn. Allerdings muss ich sowieso offen zugeben, nicht zu wissen, was Pepe hiermit überhaupt erreichen wollte. Der einzige Beweis, der damit erbracht wäre, wäre der, dass Kersten sich nicht mit Helena, sondern mit einer anderen Frau in der Pension aufhält. Und mehr nicht. Ja gut, und Taft ist blamiert. Wie gewünscht.
Inwiefern soll das aber, verdammt nochmal, Kerstens Suspendierung rückgängig machen? Kersten könnte doch trotzdem immer noch die Anzeige aufgegeben haben. Ebenso wenig wäre damit bewiesen, dass er nicht doch noch mit Helena zusammen ist – er könnte ja schließlich fremdgehen. Und überhaupt frage ich mich: Helena und Kersten lieben sich. Wie soll die Beziehung zukünftig weitergehen? Will man die auf ewig hinter dem Rücken des Vaters weiterführen, oder was? Könnte nicht doch noch einmal jemand Pepe ins Gewissen reden und ihn bitten, den missglückten Scherz mit der Verlobungsanzeige aufzuklären? Ich glaube, das würde alles viel einfacher machen. Man könnte vielleicht auch in einem günstigen Moment sich einfach mal zu dritt an einen Tisch setzen – Helena, Kersten und Taft – und das Thema erörtern.
Gut, da waren jetzt ziemlich viele Konjunktive mit dabei dafür, dass wir uns die Fragen rund um Kerstens Entlassung und Liebschaft mit der Taft-Tochter nur wenige Augenblicke, nachdem der zweifelhafte 13-Stufen-Plan so schön funktioniert hat, ohnehin nicht mehr stellen müssen. Pepe hat nämlich einen elementaren Punkt in seinem tollen Plan übersehen: Er, seine Klassenkameraden und Kersten hätten doch lieber eine Minute warten sollen, bis Taft mit dem Taxi auch wirklich abgefahren ist, anstatt, kaum dass der peinlich berührt zur Tür raus ist, umgehend in Jubelschreie auszubrechen. Denn kaum herrscht Jubel, Trubel, Heiterkeit, kommt Taft noch einmal zurück, um seinen vergessenen Hut abzuholen. Als er die Feiermeute da so einträchtig zusammensitzen sieht, ist für ihn plötzlich alles klar: Das war alles ein abgekartetes Spiel, wahrscheinlich sogar von Kersten selbst. Tja, Pech gehabt, Herr Lehrer, jetzt kommt das Disziplinarverfahren erst recht.
Hä? Disziplinarverfahren? Welcher Vergehen hat sich Kersten noch mal schuldig gemacht? Reicht eine falsche Verlobungsanzeige in seinem Namen? Wenn ja, schlage ich nochmals vor, dass Pepe einfach zugeben könnte, sie selbst aufgegeben zu haben. „Man fasst es nicht“, nölt Pepe seinen Trademark-Spruch in diesem Teil resümierend (zum mittlerweile vierten Mal in diesem Film) direkt in die Kamera. Und ja, man fasst es wirklich nicht.
Aber es wäre doch gelacht, wenn damit bereits aller Tage Abend wäre. Am nächsten Tag soll nämlich der neue Brunnen des Mommsen-Gymnasiums eingeweiht werden, und da der Kultusminister höchstpersönlich kommt, möchte Pepe die Gelegenheit nutzen, Taft ein weiteres Mal zu blamieren – indem er die Brunnenanlage mit Feuerwerkskörpern versieht! Ich bezweifle stark, dass das den geschätzten Dr. Kersten retten wird. Oder soll es ihn am Ende gar nicht retten, weil Pepe mit seinem Latein, das er ja eh nicht kann, am Ende ist?
Taft möchte den Besuch des Kultusministers dafür nutzen, diesem einen Brief über die unverschämten Machenschaften des Dr. Kersten zu überreichen (die ja wie gesagt aus einer falschen Verlobungsannonce und… äh… ja, was eigentlich? … der Beziehung zu seiner erwachsenen Tochter bestehen). Die Sache hat nur einen Haken – und jetzt kommt der große Plot-Twist –: Dr. Kersten ist der Neffe des Kultusministers! Zähneknirschend hält Taft den Brief im letzten Moment doch noch zurück – und er tut gut daran, denn der Kultusminister hat weitere brandheiße News: Sein Neffe hätte ihm bereits von seiner anstehenden Verlobung mit Helena erzählt, und damit sei man künftig ja quasi verwandt.
Halten wir also fest: Helena und Kersten verloben sich nach einem gemeinsamen Abendessen und einem Kuss, und Taft bleibt nichts anderes übrig, Kersten als seinen baldigen Schwiegersohn akzeptieren zu müssen. Ist das nicht ein MEGA-Happy End? Aber es kommt noch besser, und aus dem MEGA-Happy End wird ein MEGA-MEGA-Happy End, weil auch Pepe zu seinem persönlichen Glück kommt – und damit meine ich nicht das Feuerwerk, das im nächsten Moment losgeht. Das möchte Pepe vorher sogar noch explizit verhindern, weil sich ja nun alles zur Zufriedenheit aller Anwesenden (Taft ausgeklammert) gelöst hätte. Warum auch immer. Pepe rettet nämlich die ebenfalls bei der Einweihung anwesende Geneviève vor dem selbst angerichteten Chaos und zerrt sie an die Hauswand der Schule, die sich meines Erachtens nicht unbedingt zum Schutz vor etwaigen Silvesterraketen eignet. „Oh Pepe, du hast mich gerettet“, jubelt Geneviève und drückt Pepe einen unverdienten Kuss auf den Mund.
Äh. Was auch immer. Soll das jetzt eine Love-Story zwischen Geneviève und Pepe andeuten, obwohl Pepe bislang zu keinem Zeitpunkt Interesse für sie bekundet hat und sie auch nicht an ihm? Oder ist das nur ein Dankeskuss? Warum sollten die Aktionen der Figuren Sinn machen, wenn es schon die Streiche nicht tun? Naja, in Teil 2 erfahren wir dann ja sicherlich, was aus den beiden geworden ist. Solange sich da nicht herausstellt, dass sie Bruder und Schwester sind, machen sie ja so oder so nichts Verbotenes…
Der Abspann folgt – und das allein wäre ja langweilig, weshalb wir uns noch analog zum Vorspann ein Lied anhören dürfen, das aber zum Glück nicht einmal halb so lang ist:
„Man fasst es nicht, man fasst es nicht,
was alles so passiert.
Im Schabernack, im Schabernack, da sind wir alle sehr beseelt.
Und die Moral von der Geschicht‘:
Die Schulzeit ist doch schön.“
ENDE.
Es ist ja praktisch bereits im allerersten Satz dieses Reviews angeklungen, also kann ich mich genauso gut an dieser Stelle noch einmal wiederholen: „Die Lümmel von der ersten Bank“ ist antiquierter Klamauk aus der Mottenkiste. Das ist eine Riesenüberraschung, nicht wahr? Wer hätte das auch gedacht? Jeder, der auch nur ein paar Sekunden einschaltet, würde das sofort erkennen – und jeder, der von der Existenz der „Lümmel“-Reihe weiß, weiß das auch. Insofern kann ich hier nun wirklich nichts bahnbrechend Neues mehr erzählen.
Ein bisschen ausholen möchte ich trotzdem noch, weil ich es nämlich wirklich etwas schade finde, dass die Macher lieber auf Nummer Sicher gingen und Altbewährtes in alten Schläuchen präsentierten, anstatt sich ernsthaft mit dem Schulwesen Ende der 60er-Jahre auseinanderzusetzen und es satirisch zu überspitzen, wie das anscheinend Herbert Rösler in der Vorlage gemacht hat. Die an wenigen Stellen eingestreuten Seitenhiebe gegen die Lehrerschaft, die größtenteils noch im Zweiten Weltkrieg dienten und mit ihren Ansichten offenbar genau da hängen geblieben sind, können nicht überzeugen, weil diese Seitenhiebe von einem Drehbuchautoren ausgeteilt werden, der mit seinem Humorverständnis selbst in der Steinzeit festhängt. Während man in Hollywood das bis dato gültige Kinosystem komplett auf links drehte und die jungen Wilden die Studios mit ihren kreativen Ideen überrollten und dabei ebenso eckige wie heutzutage bedeutende Werke wie „Easy Rider“ und „Bonnie und Clyde“ inszenierten, blieb man hier in der Vergangenheit haften und lieferte Gags und sogenannte Pointen, die man sich auch gut in der Komödienlandschaft der 50er-Jahre hätte vorstellen können. Einige junge vielversprechende Schauspielerinnen wie Uschi Glas, Gila von Weitershausen und Hannelore Elsner deuten den Zeitenwechsel bereits an, aber ansonsten zeigt sich „Die Lümmel von der ersten Bank“ deutlich rückwärtsgewandt wie eben jene Lehrer, über die sich der Film lustig macht. Somit kann man als Attribute festhalten: plump statt bissig, betulich statt frech, antik statt frisch.
Selbst die Streiche, auf die ich mich seinerzeit als Schüler immer gefreut habe, können wir in die muffige Kellerecke schleudern. Am einprägsamsten ist wie gesagt noch der Selbstmord-Streich, weil er direkt auf die Psyche eines nervenschwachen Lehrers abzielt und für ihn ja auch nicht ohne Folgen bleibt. Auch der falschen Gedenkfeier kann ich aufgrund der „Ich weiß zwar nicht, worum es geht, aber ich tu‘ mal so, als ob“-Reaktion von Direktor Taft noch etwas abgewinnen, aber den kompletten Rest können wir bequem in der Pfeife rauchen. Schlichtweg unlustig sind die beiden Streiche, die mit Frau Dr. Pollhagen gespielt werden (Toilette und Reißverschluss), der falsche Feueralarm und der offenbar als – im wahrsten Sinne des Wortes – knalliges Feuerwerk gedachte Brunnen-Streich im Finale. Wenigstens kann man dabei dem Autor aber wenigstens „nur“ unterstellen, in Sachen Witz deutlichen Nachholbedarf zu haben. Schlimm sind aber die Streiche, bei denen wir selbst nicht aufgeklärt werden, welches Ziel Pepe damit verfolgt. Dazu zählt die Idee, Dr. Kersten unter tatkräftigem Einsatz einer „Zische“ zu verwirren (weshalb es auch nur gerecht ist, dass der Pauker damit nicht hinters Licht geführt werden kann und Pepe wenigstens für einen kurzen Moment mal blöd gucken darf), vor allem aber seine völlig unverständlichen Scherze, die er Direktor Taft spielt: die vermeintliche Verlobung von dessen Tochter mit Kersten, die Pepe im Namen von Taft aufgibt, und der Plan mit Geneviève als Köder, der so langatmig und kompliziert aufgebaut ist, dass der Kerl am Ende vermutlich selbst nicht mehr sagen konnte, wie er damit den frisch suspendierten Kersten zurückgewinnen wollte. Sein mehrfach angebrachtes Argument, er wolle Taft blamieren, leuchtet mir nicht ein. Klar, das gelingt ihm beide Male, aber was bringt es Kersten?
Inhaltlich hat vermutlich niemand erwartet, dass der Film Bäume ausreißt. Deshalb möchte ich mich über das dünne Grundgerüst „Beliebter Lehrer verliebt sich in die Tochter des Direktors und muss vor seiner Entlassung bewahrt werden“ und die darum gebaute episodenhafte Struktur, die immer dann besonders zum Tragen kommt, wenn irgendwo ein Lehrer reingelegt werden soll, gar nicht weiter auslassen. Die Zielgruppe war nun einmal das junge Publikum, und das sollte über widerspenstige Schüler und hilflose Lehrer lachen. Ich weiß nicht, ob das langweilige Techtelmechtel zwischen Helena und Kersten damals die Herzen höher schlagen ließ, das Millionenpublikum lässt jedoch vermuten, dass hier ganz offenbar was richtig gemacht wurde – und so viele Zuschauer hätte man sicherlich nicht erreicht, wenn man sich um höheren Anspruch bemüht hätte. Auch in den folgenden Teilen behielt man das harmlose Konzept von „Die Lümmel von der ersten Bank“ bei und nahm maximal marginale Änderungen daran vor. Die Szene mit der aufreizenden Blondine, die den Lehrer aus dem Konzept bringen soll, deutet bereits zart die bald aufkommende „Schulmädchenreport“-Welle an, aber die sieben Teile der „Lümmel“-Filme sollten stets züchtig und porentief rein bleiben (von ein paar jungen Damen in Bikini und Unterwäsche – so wie hier auch Hannelore Elsner und Britt Lindberg als dummes Blondchen Susie – einmal abgesehen).
Die Botschaft, die der Film – so will ich unterstellen – nicht zwangsläufig vermitteln will, weil die Köpfe, die dahinter steckten, mit Sicherheit eher ans schnelle Geld als an die Vermittlung einer bestimmten Aussage an die Zuschauer dachten, ist dabei eindeutig: weg mit althergebrachten, jahrzehntelang mehr oder weniger funktioniert habenden Traditionen, rein mit frischem Wind. Diese Botschaft kann auch der rückständige Humor nicht kaputtmachen. Alle Lehrer erweisen sich hier als verkalkte Exemplare, die mit den vermutlich immer gleichen Lehrmethoden in Rente gehen wollen und eben deshalb, weil sie die Jugendlichen nicht mitnehmen, gehörig den Marsch geblasen bekommen – alle bis auf Dr. Kersten, der jünger und attraktiver als die Kollegen ist und sich auf Augenhöhe mit seinen Schülern begibt, ohne ständig seine Autorität spielen zu lassen und zu zeigen, wer hier der allwissende Lehrer und wer der ahnungslose Schüler ist. Wobei sich über seinen Unterricht zugegebenermaßen nicht viel sagen lässt – wir sehen ihn ja lediglich drei Minuten bei der Arbeit. Allerdings geht er im Gasthof mit den Jugendlichen auch gemeinsam einen trinken – das schweißt natürlich zusammen und kommt gut bei den Schülern an. Man kann dem Film viel vorwerfen, aber das Plädoyer für Liberalität und Progressivität schimmert schon irgendwie durch.
Im Schauspielbereich wurde eine bunte Mischung aus jungen Leuten und alten Hasen zusammengestellt, inklusive einiger Komparsen, die man vor allem aus der damaligen Theater AG des Hamburger Gymnasiums Kaiser-Friedrich-Ufer rekrutierte. Das fiktive Mommsen-Gymnasium liegt laut Drehbuch eigentlich in Baden-Baden, aber die rund sechswöchigen Dreharbeiten fanden einmalig vorwiegend in der Hansestadt in eben dieser Bildungseinrichtung statt. Über Hansi Kraus‘ zweifelhafte darstellerische Fähigkeiten habe ich mich weiter oben ja schon ausgiebig ausgelassen, daran hat sich bis zu dieser Analyse nichts geändert. Ein Mann, der so richtig sein Herzblut für die Schauspielerei vergießt, sollte Kraus ja aber ohnehin nie werden, wie seine zwar bis heute regelmäßigen, aber doch arg sporadischen Auftritte zeigen. Wenn, dann hatte er etwa ab Mitte der 70er fast ausschließlich vereinzelt im Serienbereich gearbeitet. Als Pepe Nietnagel kehrte er bis 1972 nicht nur noch weitere sechs Male im Rahmen der „Lümmel“-Reihe zurück, sondern später auch in drei Folgen von „Ein Schloss am Wörthersee“, wo der einstige Frechdachs zu einem Kaplan mutiert ist.
Kraus‘ Filmschwester Marion ist nicht zum letzten Mal Uschi Glas, die erst drei Jahre zuvor in der Edgar-Wallace-Produktion „Der unheimliche Mönch“ ihr Debüt feierte. Mit der weiblichen Hauptrolle in „Zur Sache, Schätzchen“, einer kurz vor diesem Film inszenierten Komödie, die das Lebensgefühl junger Menschen zu der Zeit weitaus besser einfing als „Die Lümmel von der ersten Bank“, kam ihr Durchbruch. Hier macht sie ihre Sache ganz gut, die Diskrepanz in der Qualität zu Kraus ist in den gemeinsamen Szenen frappierend. Nach einer langen Pause kehrte sie im letzten Jahrzehnt wieder häufiger auf die große Leinwand zurück: In dem – wenn man es so nennen will – „Lümmel“-Update fürs 21. Jahrhundert „Fack ju Göhte“ war sie in allen drei Teilen als überspannte Lehrerin Ingrid Leimbach-Knorr zu sehen. Dazwischen stehen einige erfolgreiche Fernsehserien wie „Zwei Münchner in Hamburg“, „Anna Maria – Eine Frau geht ihren Weg“ und „Sylvia – Eine Klasse für sich“ in ihrer Vita. Generell sollte das Fernsehen ihr hauptsächliches Zuhause bleiben.
Als Helena mit von der Partie ist Gila von Weitershausen, seit 1964 regelmäßig beschäftigt in Filmen und Serien ganz unterschiedlicher Qualität. So stand sie 1971 sogar für den berüchtigten Schurken Jess Franco vor der Kamera („X 312 – Flug zur Hölle“) und ein Jahr später für Rolf Olsen in „Blutiger Freitag“. Heute hat sie sich rar gemacht und lässt sich, wenn überhaupt, in seichten Gewässern wie „Das Traumschiff“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ nieder. In „Die Lümmel von der ersten Bank“ macht sie wie ihre Kollegin Uschi Glas eine ordentliche Figur.
Als Vierte im jungen Bunde wäre die 2019 verstorbene Hannelore Elsner zu nennen, die – ich muss es noch einmal betonen – seinerzeit ein wirklich heißer Feger war und ihre Erfahrung in der Rolle der französischen Austauschschülerin Geneviève erfolgreich in die Waagschale wirft und einen quirligen (und recht entzückenden) Wirbelwind spielt. Tatsächlich hatte sie zum Zeitpunkt des Drehs auch schon acht Jahre Schauspielerei auf dem Buckel und somit mehr als die drei erstgenannten Kollegen. Bis zu ihrem Tod war sie aktiv und war sich auch nicht zu schade dafür, neben anspruchsvollen Rollen wie „Die Unberührbare“, wofür sie neben dem Bayerischen auch den Deutschen Filmpreis einheimste, auch solche in Til-Schweiger-Filmen („1 ½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“) oder peinlichen Bushido-Vehikeln („Zeiten ändern dich“) zu übernehmen. Letztmals war sie in Doris Dörries „Kirschblüten & Dämonen“ (2019) zu sehen, einer Fortsetzung von „Kirschblüten – Hanami“ (2008), in dem sie ebenfalls mitspielte.
Unter den Schülern der Lehrerschreck-Klasse 10a ist vielleicht noch Wega Jahnke eine Erwähnung wert, die nicht ganz so viele Filme und Serien im Lebenslauf stehen hat (u.a. vier „Derrick“-Folgen, drei „Der Alte“-Folgen, und auch in „Die Buddenbrooks“ tauchte ihre Nase auf) und 1998 im Alter von nur 54 Jahren starb. Hier spielt sie mit der mit Intelligenz nicht ganz so gut bestückten Schülerin Meier eine Figur, die auch in den folgenden Filmen noch vorkommen sollte – nur sie selbst eben nicht.
Kommen wir zu den Lehrern, und da wäre an allererster Stelle sicherlich Theo Lingen als Dr. Gottlieb Taft zu nennen, der schon fast 40 Jahre als Schauspieler im Geschäft war, bevor er die Rolle des Oberstudiendirektors übernahm. Schon 1933 hielt er für den legendären Fritz Lang in „Das Testament des Dr. Mabuse“ sein Gesicht in die Kamera und arbeitete sich in Film und Theater mit seiner stark näselnden Stimme durch spießbürgerliche Charaktere sowohl in heiteren als auch in ernsthaften Filmen. Hier ist er mit Hingabe dabei und lässt sich, falls er vom Drehbuch nicht überzeugt gewesen sein sollte, nichts anmerken. Er starb 1978 in dem Jahr, als der völlig unsägliche und vermutlich den Tiefpunkt seiner Karriere darstellende „Lady Dracula“ seine Erstaufführung feierte. Ich möchte allerdings keinen Zusammenhang herstellen.
Was für Lingen gilt, gilt konsequent auch für die anderen Darsteller, die sich als Lehrer primitivem Klamauk ausgesetzt sehen und sich dabei nur allzu oft zum Affen machen müssen: Sie sind mit Eifer bei der Sache. Mein persönlicher Favorit wird immer Rudolf Schündler bleiben, der den menschgewordenen Nervenzusammenbruch Professor Dr. Arthur Knörz so glaubhaft verkörpert, dass ich ihn immer mit dieser Rolle verbinden werde, auch wenn er in so fulminanten internationalen Horrorproduktionen wie „Der Exorzist“ und „Suspiria“ ebenso auftaucht wie in Wim-Wenders-Filmen („Im Lauf der Zeit“ und „Der amerikanische Freund“). Ihm gelingt es dabei, den Pauker so hilflos anzulegen, dass man auf der Stelle Mitleid mit ihm empfindet. Das sahen vermutlich zur Drehzeit auch andere Zuschauer so, weshalb Autor Seitz seine Figur später mit längeren Auftritten und sogar einem ausgedehnten Privatleben belohnte. Neben Lingen ist er als Einziger aus dem Paukerpersonal in allen Teilen der Reihe zu sehen.
Balduin Baas als Dr. Blaumeier gibt ebenfalls alles, und wenn das bedeutet, einer Schülerin einen angeblichen Spickzettel aus dem Ausschnitt ziehen zu müssen. Besonders schlimm: seine Imitation eines echten Feuer- und eines Probealarms, aber er mimt den Kasper mit Inbrunst. Wenn das Drehbuch das fordert, macht er das. Für Helmut Käutner debütierte er 1954 in „Des Teufels General“ und war dann später auch in der Edgar-Wallace-Verfilmung „Der Hexer“ zu sehen (und auch in einer scheußlichen Neuverfilmung, „Das Schloss des Grauens“ mit Gunter Berger als Chefinspektor Higgins). Als ihn der legendäre Italo-Regisseur Federico Fellini 1978 in „Die Orchesterprobe“ in der Hauptrolle als Dirigent besetzte, konnte er auch international auf sich aufmerksam machen.
Verheiratet war er mit der Schauspielerin Ruth Stephan, die als Dr. Mathilda Pollhagen auch in „Die Lümmel von der ersten Bank“ unterwegs ist. Neben Heinz Rühmann hatte sie oft auch Heinz Erhardt an ihrer Seite, aber ihre wohl bekannteste Rolle ist diese hier. Mit ihrer schrulligen Art ist sie eindeutig Sympathieträgerin, muss hier aber auch einige erniedrigende Scherze über sich ergehen lassen, gerade wenn Pepe ihr Oberteil zerreißt und sie leicht entblößt vor der gackernden Schülerschar steht. 1975 starb sie im Alter von nur 49 Jahren an Brustkrebs.
Oliver Hassencamp spielt in der Rolle des Studienrates Priehl im Vergleich zu den anderen genannten Lehrern eine untergeordnete Rolle. Insofern hat er auch keine großen Möglichkeiten, sich irgendwie auszuzeichnen. Die Figur soll deshalb in diesem Teil auch das erste und einzige Mal auftauchen, danach nie wieder. Hassencamp selbst ist allerdings im letzten Teil noch einmal zu sehen: als Mitglied der Ministerialratskommission. Er kam 1988 bei einem Autounfall ums Leben, seine Frau überlebte schwer verletzt.
Auf der „guten“ Seite der Lehrerschaft (die „gute“ Seite fällt mit gerade mal einer Person sehr klein aus) hätten wir Günther Schramm, der den zumindest bei seinen Schülern – und auch bei den Frauen – beliebten Dr. Kersten spielt. 1970 bis 1972 und 1975 wurde er mit einem Bambi ausgezeichnet, und er trägt sogar den bedeutenden Titel „Pfeifenraucher des Jahres 1974“. Der immer noch lebende Schramm (90 Jahre beim Verfassen dieses Reviews) stand zuletzt 2017 für eine Folge „SOKO 5113“ vor der Kamera und genießt ansonsten hoffentlich mit seiner Frau, der Schauspielerin Gudrun Thielemann, seine Rente in vollen Zügen. 2007 bis 2013 hatte er eine durchgehende Rolle in „Forsthaus Falkenau“. Tatsächlich kommt er in diesem Film recht sympathisch rüber – eben wie der Lehrer, mit dem man zu Schulzeiten gern einen trinken gegangen wäre, ohne sich dessen zu schämen, wenn wir denn mal sein unverhohlenes Gebaggere an jungen Frauen, die wie Schülerinnen aussehen, großzügig ausklammern. Er sollte hiernach nicht wieder in der Reihe auftauchen, seine Figur aber im letzten Teil wiederkehren.
Tja, und absolut unvergessen bleibt wie gesagt Hans Terofal, der als Pedell Georg Bloch atemlos durch diesen Film hetzt, als gäbe es kein Morgen mehr. Er ist mehr noch als alle Lehrer zusammen der Trottel vom Dienst und fühlt sich in der Rolle offenbar wohl, zumal er sie auch in anderen Klamauk-Gurken bis 1975 immer und immer wieder spielte. Auch in der „Lümmel“-Reihe ist er in jedem Teil anwesend. Objektiv gesehen ist er völlig unerträglich, und meine Bewunderung für ihn gilt auch ausschließlich seiner unglaublichen Agilität über den gesamten Serienzeitraum. Vielleicht hätte er den Deppen noch mehrere Jahre weitergespielt, hätte ihn seine Alkoholsucht nicht ins Koma geführt, aus dem er nicht mehr erwachen sollte. Wie Ruth Stephan war ihm kein langes Leben beschieden: Er starb 1976 53-jährig.
Außer acht lassen kann ich an dieser Stelle natürlich auch einen so berühmten Schauspieler (und Synchronsprecher von Jack Lemmon) wie Georg Thomalla nicht, auch wenn der in diesem Film nur die zweite Geige spielt. Er tut das, was er am besten kann: den aufgedrehten Krawall-Komiker spielen, auf dessen Kosten viele Gags gehen. Als seriösen Charakterdarsteller hat man ihn ja eigentlich nie gesehen, entsprechend ist auch sein Kurt Nietnagel laut und polterig und dabei ziemlich schusselig. Das kann er, und mehr hat auch niemand von ihm verlangt. Es sollte sein einziger Auftritt in der „Lümmel“-Reihe bleiben.
In weiteren Nebenrollen: Monika Dahlberg als Schulsekretärin Fräulein Weidt, die wir später in der Serie noch wiedersehen werden, sowie Ursula Grabley als Frau Taft und Ilse Petri als Mama Nietnagel, die wiederum in der Serie nicht mehr gesehen werden sollten, dafür aber zumindest die Figuren, die sie verkörpern. Jürgen Drews hat auch einen Auftritt, noch unbekannt genug, um namentlich nicht genannt zu werden. Und er hat neben seiner Beatles-Imitation sogar ein paar Dialogzeilen.
„Die Lümmel von der ersten Bank“ war also der Startschuss für eine relativ kurzlebige (im Vergleich zu besagten „Schulmädchenreporten“), aber sehr erfolgreiche Reihe, die bis heute gern gesehener Gast in den Dritten Fernsehprogrammen ist. Sie zog neben den ganzen Fortsetzungen eine Reihe weiterer Pauker-Filme nach sich, die das Erfolgsrezept mit den frechen Schülern und den doofen Lehrern kopierten, ohne aber auch nur einen Hauch kreativer zu sein – und das ist schon enttäuschend, wenn man bedenkt, dass bereits dieser erste Teil alles andere als originell ist. Im Gegenteil: Er legt Zeugnis über das zweifelhafte angestaubte Humorverständnis der damaligen Zeit ab und ist eines der unzähligen Beweisstücke dafür, was im Komödienkino unserer Eltern- und teilweise Großelterngeneration alles falsch lief. Selbst die Frische, die die Hippie-Ära ins Kino blies, war nur ranziger Muff, den wir am liebsten in die nächstbeste Kiste verstauen sollten, damit bloß nie jemand erfährt, wie schrecklich unlustig unsere Kult-Komödien der damaligen Zeit doch waren. Und auch wenn dieser Startschuss nicht durchweg grausam ist, weil er wenigstens einprägsame Lehrertypen und motivierte Darsteller hervorbrachte und die Moral von der Geschichte letztlich das Abwenden vom Alten hin zu neuen Ufern propagiert, funktioniert „Die Lümmel von der ersten Bank“ für mich heute nur noch auf der nostalgischen Schiene. Die „Lümmel“-Reihe sollte schlimmere (musikalischere!!) Exemplare hervorbringen, aber das darf bei ihrem generell äußerst mäßigen Niveau kein Maßstab sein. Selbst aus Trash-Gesichtspunkten (abgesehen von ein, zwei Streichen gibt es streng genommen nichts, was erwähnenswert wäre) kann ich hierfür gerade mal fünf Bier geben – und die sind schon äußerst großzügig.
BOMBEN-Skala: 6
BIER-Skala: 5
Review verfasst am: 29.07.2021

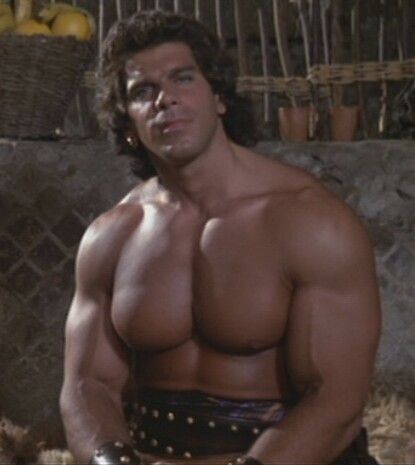
Oliver Hassencamp war ja auch der Autor der „Burg Schreckenstein“- Geschichten und hat schon mit Hansi Kraus (sowie Hans Terofal und Rudolf Schündler) in der Reihe der „Lausbuben-Geschichten“ gespielt.
Bei Rudolf Schündler nicht zu vergessen, dass er in den Siebzigern auch mal in Pornos mitspielte. Wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, war er in Bilians erstem Mutzenbacher der Pfarrer, der auch über die Josefine rübersteigen durfte.