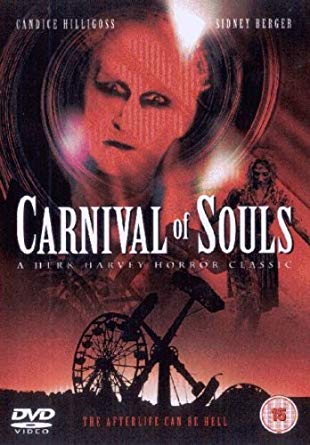
- Deutscher Titel: Carnival of Souls
- Original-Titel: Carnival of Souls
- Alternative Titel: Tanz der toten Seelen |
- Regie: Herk Harvey
- Land: USA
- Jahr: 1962
- Darsteller:
Candace Hilligoss (Mary Henry), Frances Feist (Mrs. Thomas), Sidney Berger (John Linden), Art Ellison (Minister), Stan Levitt (Dr. Samuels), Tom McGinnis (Organ Factory Boss), Herk Harvey („The Man“)
Vorwort
Ob Kalifornien, Kentucky oder Kansas, Teenager und ihr Entertainment sind doch immer gleich. In unserer kleinen Stadt im Mittleren Westen fordern zwei Jungs in ihrer Motordroschke drei Mädels in ihrer Mühle (Frauen am Steuer? Welch progressiver Bundesstaat!) zu einem kleinen Rennen heraus. Die Girls akzeptieren – off they go, was soweit gut geht, wie das Geläuf ordnungsgemäß asphaltierte Straße ist. Die wurmstichige Holzbrücke, die notdürftig mit als „Spur“ gelegten Brettern aufgepeppt wurde, würde ich hingegen nicht mal zu Fuß überqueren, bevor ich nicht eine Christian-Bale-in-THE-MACHINIST-Hungerkur durchgezogen habe, geschweige denn mit einem bzw. ZWEI Autos (nebeneinander!!) drüberdengeln. Der Fahrer des XY-Teams greift, da die Girls wider Erwarten ordentlich mithalten, zu dezent unlauteren Mitteln wie dem ein oder anderen leichten Anklopfer an den Kotflügeln der Damenschleuder. Es sind verhältnismäßig sanfte Handgreiflichkeiten, nicht dazu gedacht, den Kontrahenten von der Strecke zu schubsen, sondern nur, um ihn zu veranlassen, doch mal den Gasfuß etwas zu lupfen. Frau lupft nicht, sondern schraubt sich vergleichsweise unbedrängt durchs Brückengeländer. Die Karre geht erst kurz fliegen, dann schwimmen, versinkt aber binnen Sekunden malerisch im tiefen Fluß.
Bei den rasch eingeleiteten Bergungsmaßnahmen herrscht Missstimmung. Die Kombination aus sandigem Untergrund und starker Strömung (letztere bloße Behauptung entgegen dem Augenschein) lässt es unwahrscheinlich erscheinen, das Unfallfahrzeug und seine Insassinnen zu finden. Doch da! Aus dem Wasser und dem Matsch krabbelt eine weibliche Gestalt, schmoddrig-schmutzig von Haar- bis Zehenspitze, aber ansonsten not worse for the wear. Es ist Mary Henry (Candace Hilligoss, THE CURSE OF THE LIVING CORPSE), und wie sie sich aus dem versunkenen Autowrack befreit hat, kann sie leider nicht sagen. Amnesie aufgrund eines schweren Schocks – das wundert selbst in der amerikanischen Provinz anno 1962 niemanden sonderlich.
Was allerdings schon jemanden sonderlich wundert, ist wie nonchalant Mary ihr Nahtoderlebnis (und das damit verbundene Absaufen von zwei Freundinnen) verarbeitet. Mary arbeitet (?) in der Orgelfabrik (womit man alles sein Geld verdienen kann), und deren Besitzer (Tom McGinnis) ist bass erstaunt, wie ungerührt sie in die Tasten der big-ass-Orgel, die die Fabrik gerade fertiggestellt hat, haut. Es ist sozusagen Marys Abschiedskonzert, denn sie hat einen Job als Kirchenorganistin in Salt Lake City aufgetan, und tragischer Unfall oder nicht, bezahlte (!) Jobs für Organistinnen wachsen selbst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten nicht auf Bäumen, also wird sie ihn übermorgen antreten, auch wenn’s für sie keine Herzensangelegenheit ist, Christenhymnen zu performen, ein Job ist ein Job ist ein Job. Und den langen Weg nach Utah wird sie mit einer couragierten Nachtfahrt im eigenen Automobil bewerkstelligen. Der Fabrikboss und sein Zimmermann (Forbes Caldwell) sind sich einig, dass Mary schon vor ihrem Unfall eine leichte Meise hatte, und jetzt ist die halt etwas gewachsen. Des Chefs freundliches Angebot, doch mal wieder vorbeizuschauen, wird brüsk ausgeschlagen – Mary ist sich absolut sicher, dieses Provinzkaff niemals mehr im Leben zu betreten.
Lange Autofahrten machen müde, das weiß jeder, und wenn das Autoradio dann auch nur seltsam-diffuse Orgelmusik abspielt, ist das auch nicht gerade ein akustischer Red Bull. Mary wird eher von dem seltsamen, großen Gebäude abseits der Straße, ein paar Meilen vor Salt Lake City, wachgehalten, denn irgendwie scheinen Gebäude, Musik und Marys Geisteszustand miteinander in Verbindung zu stehen. Für den ordentlichen Schreck in der Abendstunde sorgt aber das ghoulische Gesicht eines unheimlichen Mannes (Regisseur Herk Harvey himself), das sich – physikalisch völlig unmöglich – in der Seitenscheibe materialisiert. Mary fährt geschockt gleich mal in den Straßengraben, verdient sich aber erstaunliche Emanzipationspunkte dafür, ihre Fahrzeug nach einem heftigen Durchschnaufer ohne fremde (männliche) Hilfe wieder aus der prekären Situation zu befreien. An der nächsten Tankstelle erkundigt sich Mary nach dem Gebäude – der Tankwart weiß Bescheid und erklärt – als es hier vor etlichen Jahren noch einen echten, feuchten See gab, war es ein beliebtes Badehaus. Nach der Auflassung des Sees fristete das Gebäude seine Zeit zunächst als Tanzhalle, dann als Herzstück eines Rummelplatzes, aber seit einigen Jahren vergammelt es nur noch vor sich hin (which is indeed the true story des Gebäudes, dessen zufällig Entdeckung bei einer langen Autofahrt Harvey überhaupt erst auf die Idee brachte, diesen Film zu machen). Mary lässt sich noch die Richtung zu ihrer Pension weisen und dampft ab.
Ihre Vermieterin, Mrs. Thomas (Frances Feist), führt eigentlich keine „richtige“ Pension, sondern vermietet nur zwei Zimmer ihres für sie allein viel zu großen Hauses. Der andere Mieter ist zur Zeit nicht da, aber man wird sich sicher kennenlernen und verstehen. Die Thomas selbst ist auch nett genug, wenngleich auf die altmodisch-aufdringliche Art älterer Damen, die nichts anderes zu tun haben, und das Zimmer (mit eigenem Bad!) ist auch gemütlich genug, ums dort aushalten zu können. Dies geklärt, sucht Mary ihren neuen Arbeitsplatz auf. Es handelt sich, wie der Vorstehhund der Gemeinde (Art Ellison, PAPER MOON ,SHOOT IT BLACK, SHOOT IT BLUE) erläutert, um eine kleine Gemeinde (was mich nicht wundert, da es offenbar keine mormonische ist, was ich schon allein daran festmache, dass der Pfaffe sein Gotteshaus tatsächlich „Kirche“ und nicht „Tempel“, wie die Latter Day Saints es ja zu tun pflegen, nennt), aber offenbar eine mit finanzkräftiger Klientel, denn eine Vollzeit-Organistin muss man sich ja auch als Glaubenszirkel erst mal leisten können. Mary legt sich gleichmal zwecks Kennenlernen der Orgel ins Zeug und der Pfarrer ist verzückt – „wir haben eine Organistin gefunden, die die Seele berührt!“ Seeleschmeele, wäre wohl Marys Antwort, denn auch dem Gottesmann nagelt sie unbefangen an die Soutane, dass ihr die spirituelle Komponente der geistlichen Musik glatt am geschmeidigen gluteus maximus vorbeigeht – solang jemand harte grüne Dollar dafür bezahlt, spielt sie auch den River-Kwai-March oder die Titelmusik von Dragnet. Da juckt’s den Pfaffen schon ordentlich am Heiligenschein. Nichtsdestoweniger lässt sich der Kreuzträger, der ein außerhalb der Stadt wohnendes Schaf seiner Herde besuchen will, breitschlagen, Mary mitzunehmen, damit die sich den Rummelplatz mal ansehen kann. Aus Sicherheitsgründen ist das Gelände abgesperrt, aber Mary bemerkt, dass der Zaun genügend Lücken hat, um durchzuschlüpfen und die Ex-Amüsiermeile einer detaillierteren Untersuchung zu unterziehen. Das aber nicht mit dem Paster, der rightfully bemerkt, dass es sich für einen Mann seiner Profession eher nicht gehört, Haus- und Landfriedensbruch zu begehen. Mary muss ihre Neugier also einstweilen zurückstellen.
Sie kehrt also in die Pension zurück und schreitet zu einem Entspannungsbad. Das wird geringfügig gestört durch den energischen Versuch ihres Pensions-Mitgasts John Linden (Sidney Berger, der’s in einem Cameo tatsächlich auch in das Remake-in-name-only WES CRAVEN’S CARNIVAL OF SOULS geschafft hat), die neue Nachbarin jetzt unbedingt kennenlernen wollen zu müssen. Notdürftig in ein Badetuch und einen Pyjama gewickelt, gelingt es Mary halbwegs, Johnnys Zudringlichkeit im Rahmen des ziviilsatorisch Genehmigten zu halten und ihn freundlich, aber bestimmt, unter Verweis auf „morgen, Tara, ist auch noch ein Tag“, hinauszukomplimentieren. Nichtsdestotrotz ist die Nacht nicht ruhig – Geräusche aus dem Treppenhaus dringen an Marys empfindliche Horchmuschel, und ein prüfender Blick hinaus lässt sie erkennen – der Ghoul aus ihrer Auto-Vision strolcht durchs Gemäuer. Kreisch und Panik, aber die alarmierte Mrs. Thomas kann nur wahrheitsgemäß auskunften, dass es keine unerlaubte männliche Anwesenheit im Hause gibt. Hmmm…
Der Morgen beginnt wie der Abend endete – mi t einem ungebetenen Besuch von John Linden, doch da Johnnybonny jetzt Kaffee dabei hat und sich zudem für sein ungebührliches Verhalten vom Vortag entschuldigt, ist er deutlich willkommener. Den angebotenen alkoholischen Schuss ins Gebräu lehnt Mary allerdings dankend ab. Johnny versucht weiter zu flirten, beißt aber nach wie vor auf einigermaßen stabilen Granit, und auf mysteriöse nächtliche Geräusche und Besucher angesprochen, weiß er von nichts.
Mary geht dann erst mal zum Shopping. Frau ist ja schließlich mit kleinem Gepäck unterwegs, keinesfalls jedoch mit Klamotten für alle Lebenslagen. Also auf ins Kaufhaus und in die Damenmodeabteilung. Unterm Probieren bemerken wir als Zuschauer aber einen seltsamen wabernden Effekt, der übers Bild zieht, für Mary äußert sich das in einem kurzen Schwindelgefühl. Kleiner Schwindel, große Wirkung, denn die eben noch so hilfsbereite Verkäuferin ignoriert Mary nun nach Kräften und trotz Zuruf… und damit ist sie nicht allein. Mary stellt entsetzt und in zunehmender Panik fest, dass sie von niemandem mehr wahrgenommen wird, gleichzeitig sie selbst keine Geräusche, keine Sprache mehr hört. Verzweifelt rennt sie auf die Straße, in einen Park, wo ihr, wen wunderts, ihr ghoulischer Freund über den Weg läuft. Schockiert bricht Mary unter einem Baum zusammen, doch da pfeift ein kleines Vögelchen ein Lied, das tatsächlich an Marys Ohr dringt, und Mary wird in die Realität zurückgebeamt. Als sie dann noch einen arglosen Passanten angeht, im Irrglauben den Ghoul vor sich zu sehen, sieht sich ein zufällig vorbeikommender örtlicher Medizinmann, Dr. Samuels (Stan Levitt, KALTBLÜTIG), genötigt, einzugreifen und Mary mit sanftem Druck in seine Praxis zu manövrieren. Was Mary braucht, das begreift auch Samuels, ist angesichts der traumatisierenden Vorgeschichte mit Unfall und Beinahe-Absaufen ein amtlicher Klatschenheiler, er selbst ist aber kein Psychiater, sondern nur ein gemeiner Feld-, Wald- und Wiesendoktor, der feststellen kann, dass Mary körperlich nix fehlt, auch ihm allerdings ihre erstaunliche laissez-faire-Einstellung hinsichtlich ihres Unfallerlebnisses und der Übergang zur Tagesordnung spanisch vorkommt und durchaus nicht ausschließen möchte, dass Marys Visionen und Halluzinationen ein Resultat mental ungesunder Verdrängungstaktik sind. Alles schön und gut, aber Mary lässt sich davon nicht weiter beeindrucken.
Oder doch? Mary entscheidet sich, den offensichtlichen Feind – den Rummelplatz – direkt zu konfrontieren. Also fährt sie mit dem eigenen Auto hin und überwindet die Grenzbefestigungen. Mary und der Rummelplatz reagieren offensichtlich aufeinander… die abgestellten Gummiwalzen einer Funhouse-Attraktion klatschen gegeneinander, eine Rutschmatte rutscht ganz alleine und ohne Anlass eine Rutsche herunter, und, naja, ein vor sich hin verrottender Rummelplatz ist an und für sich, per se und ganz ohne übernatürlichen Brimborium schon eine ausgesprochen creepy Angelegenheit. Dass der Ghoul hinter jeder Ecke lauert, versteht sich von selbst… Also nimmt Mary nach einer Weile lieber doch Reißaus, bevor sie dem Geheimnis des Rummels auf die Spur kommen kann…
Als sie in der Pension John über den Weg läuft und der, obwohl bislang mit der bewährten cold-fish-Taktik erfolgreich abgebürstet, sich immer noch unrealistische Hoffnungen darauf macht, Mary baldmöglichst in den Schlüpfer zu steigen, erinnert sie sich tatsächlich an Samuels‘ Rat, es doch mal mit sozialem Kontakt und diesem unbekannten Terrain „Freundschaft“ zu versuchen, und willigt ein, sich nach der Orgelprobe von Johnny abholen und auf ein Tänzchen ausführen zu lassen.
Es wird also wieder geklimpert, aber Mary driftet geistig schnell von der barocken Hymne ab und entlockt der Orgel, begleitet von Visionen ghoulischer Untoter, die aus dem Wasser auftauchen und im ruinösen Ballsaal des Rummelpark-Hauptgebäudes eine forsche Sohle aufs Tanzparkett legen, seltsame, „eerie“ Klänge wie die, die seinerzeit auf dem Weg nach Salt Lake aus ihrem Autoradio tönten. Das gottlose Gedudel ruft den Paster auf den Plan und der ist heute ganz Kunst- und Musikkritiker. Die Musik, die Mary da offenkundig improvisiert, ist „profan“ (oh boy, ich glaube, der Gottesmann schaltet selten das Radio ein… da hat auch 1962 ganz andere „profane“ Musik zu bieten) und „blasphemisch“ (bah, es war jetzt nicht gerade „Sataaaaan, lead us into hell…“). Und wer solch diabolische Musik spielt, ist vermutlich ein schlechter Mensch und daher auf der payroll einer anständigen christlichen Gemeinde untragbar. Will sagen- Mary wird on the spot gefeuert, was aber nicht heißt, dass der Priestersmann nicht für etwaige seelsorgerische Tätigkeiten, die die frischgebackene Arbeitslose seiner Ansicht nach dringend nötig hat, zur Verfügung stünde. Mary verzichtet dankend.
Aber es wäre jetzt zumindest einigermaßen verständlich, warum Mary in der Teenie-Diner-Spelunke, in die Johnny sie abschleppt, okay, nicht gerade ausdrücklich Trübsal bläst, aber nun auch nicht spezifisch aufgeschlossen auf seine Versuche reagiert, sie in Richtung Tanzfläche zu bugsieren. Nachdem Mary weiterhin die Taktik emotionsloser Roboter ausspielt, und Johnnys Annäherungsversuche mit eindeutigem Desinteresse zurückweist, gleichzeitig aber bekundet, un-be-dingt den Abend mit Johnny verbringen zu wollen, fühlt sich der – nicht ganz unberechtigt – geringfügig verscheißert und lehnt daher ob Rückkehr zur Pension entschieden ab, Mary, die nun leicht hysterisiert-verängstigt darauf besteht, dass er noch bei ihr bleibt, anstandswauwaumäßig durch die Nacht zu geleiten. Der Ghoul jagt Mary weiter ordentlich ins Bockshorn, und aus Furcht, der geheimnisvolle Unbekannte könnte in ihr Domizil eindringen, beginnt sie eine nächtliche Umgestaltung der Wohnverhältnisse.
Nicht unbedingt zur Freude von Mrs. Thomas, die a) an ihrem Schlaf und b) an der althergebrachten Konfiguration ihrer Möbelstücke hängt und nun ebenfalls den priesterlichen Schluss „Mary must go“ gezogen hat. So schnell macht man sich beliebt. An Mary soll das auch nicht scheitern, sie packt ihre Siebensachen und sattelt ihr Motorhuhn, um auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden.
Alas, so’n Auto ist bekanntlich auch nur ein Mensch, und Marys fahrbarer Untersatz ist krank. Das fällt sogar Mary auf, die das Gefährt direktemang in eine Kfz-Werkstatt auf die Hebebühne steuert. „Getriebeschaden“, vermutet der Mechanikus und zuckt die Schultern, als Mary darauf besteht, die Reparatur im hochgepumpten Fahrzeug abzuwarten. Wer zahlt, schafft an, und nen größeren Dachschaden als sie eh schon hat, kann Mary sich vermutlich jetzt auch nicht mehr einfangen. Dummerweise ist unser Mechaniker auch in Personalunion einziger Tankwart der angeschlossenen Zapfsäulenanlage und ein Tankkunde kann jetzt understandably nicht warten, bis der Mechaniker ein Getriebe ausgetauscht hat, also muss er Prioritäten setzen und erst mal den Tankkunden verarzten. Das nutzt Mary selbstverständlich stantepete dazu, wieder in Visionen des Ghouls und des unheimlichen Carnivals auszubrechen und demzufolge gelinde in Panik zu geraten. Als sie wieder bei Sinnen ist, ist das Auto rätselhafterweise wieder auf Bodenniveau.
Da das Fahrzeug ja trotzalledem immer noch kaputt ist, bedarf es einer anderen Möglichkeit, die Stadt eiligst zu verlassen. Öffentliche Verkehrsmittel in Form von Bussen bieten sich an. Auf dem Weg zum Bus-Terminal streift wieder der unauffällige Wabereffekt übers Bild, und, tja, es geht zurück ins Land der Unsichtbaren und Gehörlosen für Mary. Wieder kann sie niemand wahrnehmen, wieder sind alle Geräusche ausgeblendet, wieder ist der einzige, der Mary als tatsächlich existente Person erfasst, nur ihr fieser Freund, der Ghoul. Panik! Nachdem sie beinahe im Busbahnhof eingeschlossen wird (weil, wie gesagt, sieht sie ja keiner…), irrt sie durch Hinterhofgassen, bis sie wieder unter dem gleichen Busch im Stadtpark und unter dem mutmaßlich gleichen singenden Vögelchen zusammenbricht, was sie erneut in die Realität zurückholt. Schockiert sucht sie Dr. Samuels auf und klagt ihr Leid, doch der vermeintlich wohlmeinende Doktor dreht ihr in seinem Chefsessel den Rücken zu… kein Wunder, denn es ist nicht der Doktor, sondern der Ghoul! Kreisch!
Zu ihrer Bestürzung findet sich Mary nun wieder in ihrer- nicht aufgebockten – Karre in der Autowerkstatt wieder und gibt, da nun ordentlich mental am Kragen gepackt und durchgeschüttelt, ihrer Blechschleuder die Sporen, was den armen Mechaniker nun doch gelinde verwirrt. Mary braust zum Rummelplatz, wo sie von ihrem ghoulischen Freund und seiner untoten Ball-Gesellschaft bereits dringend erwartet wird. Untote steigen aus dem nun wieder existenten See, zombiehafte Paare schwofen im Walzertakt, und der Ghoul himself führt eine verwesende Version von Mary über den Tanzboden. Das hält nun die stärkste Bekloppte nicht aus – Mary rennt hinaus in den nun wieder staubigen Ex-See, verfolgt von der Untotenbrigade, die, als Mary pflichtschuldigst stolpert und lang hinschlägt, über sie her fällt…
Etwas später betrachten Samuels, Priester und ein Sheriff die Spuren der schönen Bescherung – sie führen auf den ausgetrockneten See, enden dann aber, ohne dass Spuren zurück führten. Ein mysteriöses Mysterium, das mysteriös bleiben wird, so die einhellige Meinung der Experten.
Doch zurück in Marys Heimat finden die immer noch eifrig im sandigen Flussbett wühlenden Rettungskräfte endlich das verunglückte Auto und zerren es ans sichere Ufer – im Wagen eingeschlossen: die Leichen dreier junger Frauen, inklusive Mary… waaaah!!!!
Inhalt
CARNIVAL OF SOULS ist ein Beispiel dafür, dass zu ihrer Entstehungszeit komplett untergegangenen Filmen manchmal doch späte Gerechtigkeit widerfährt. Der einzige Spielfilm des umtriebigen Industrie- und Dokumentarfilmers Herk Harvey wurde, wie oben angedeutet, durch Harveys Entdeckung des Rummelplatzgebäudes in der Nähe von Salt Lake City inspiriert. Harvey war von der Anlage und ihrem filmischen Potential beeindruckt und beauftragte seinen Freund und frequenten Industriefilm-Kollaborateur John Clifford mit der Ausarbeitung eines Drehbuchs rund um das Gebäude; die einzige Bedingung, die Harvey stellte – der Film müsste mit einem Tanz der Untoten enden. Clifford rasselte das Script wunschgemäß in drei Wochen runter, Harvey ging dieweil Klinkenputzen und sammelte 17.000 Dollar als zu verbratendes Budget ein, die restlichen 13.000 Dollar für Equipment und Material wurden ihm auf einer „zahl-später“-Basis gestundet. Als der fertige Film dann in die Kinos kam, hinterließ er, in einer Doppelvorführung mit dem aus drei Episoden einer schwedischen Horror-Anthologieserie (!) zusammengeklöppelten „The Devil’s Messenger“, keinerlei Eindruck und geriet praktisch am Tag seines Releases in Vergessenheit (nur nicht bei George A. Romero, der CARNIVAL OF SOULS als eine Inspiration für NIGHT OF THE LIVING DEAD zitierte – und wenn man Herk Harveys Ghoul mit dem ein oder anderen prominenten Zombie aus NIGHT… vergleicht… yeah, I can see it). Harvey kehrte zurück zu seinen Industriefilmen und Dokus, die Laiendarsteller aus Kansas in ihr normales Leben, und für die einzige Profi-Schauspielerin, Candace Hilligoss, entpuppte sich der Streifen als „career killer“ – ihr eigener Agent ließ sie fallen, nachdem sie sich für diesen Film und gegen den Richard-Hilliard-US-Proto-Giallo VIOLENT MIDNIGHT (der nun aber auch nicht gerade Bäume an den Kinokassen ausriss) entschieden hatte. Es dauerte bis 1989, als CARNIVAL OF SOULS von einigen findigen Filmfans für Halloween-Vorführungen wiederentdeckt wurde und prompt von everyone and his brother als „lost classic“ gefeiert wurde. Criterion spendierte dem Film sein Deluxe-Treatment auf Laserdisc und später DVD, Wes Craven gab seinen Namen für ein (furchtbares) Remake her, das retroaktiv das Original noch mal in höhere Sphären hob, bis der Film seinen heutigen Status als quasi der CITIZEN KANE des B-Horror-Kinos erreichte und seitdem bequem auf diesem Podest ruht. Da muss doch eigentlich ein Haken dran sein…
Das Komische ist – eigentlich nicht. CARNIVAL OF SOULS ist ein feiner Film, dessen Scheitern an den zeitgenössischen Kinokassen aber niemanden verwundern muss, ist er doch einerseits in gewisser Weise hoffnungslos altmodisch als auch in anderer Weise seiner Zeit um Lichtjahre voraus. Aber zunächst einmal muss festgehalten werden – CARNIVAL OF SOULS ist kein „Horrorfilm“ in dem Sinn, dass er versucht, sein Publikum mit oberflächlichen Tricks, Effekten oder Schocks zu erschrecken. Harveys primärer Einfluss war vermutlich Rod Serlings TWILIGHT ZONE, die seit 1959 über die Mattscheiben flimmerte und in ihren besten Momenten wirkungsvoll das Eindringen des Unheimlichen, des Unerklärlichen in den Alltag zu schildern vermochte (wenn Serling nicht gerade wieder seinem Publikum eine Moral mit der Subtilität einer Dampfwalze in die Brägen planieren wollte oder drohte, im ausgebreiteten Schmalz zu ersticken). Dank Harveys Erfahrung als Dokumentarfilmer gelingt ihm ein ausgezeichneter Kontrast zwischen der sachlichen, nüchternen „Alltagsatmosphäre“ des Films und dem Aufbrechen derselben durch die unheimlichen, gerne stilistisch an Stummfilmzeiten erinnernden (und wohl auch primär stumm gedrehten) Erscheinungen des Ghouls, der an und für sich nichts wirklich offensiv „Bedrohliches“ macht, aber als Verkörperung dieses oben angesprochenen „Unheimlichen“, nicht unbedingt des „Bösen“ (der Ghoul ist eine amoralische Erscheinung, ein Todesbote), von seinem ersten „unauffälligen“ Auftauchen in der Seitenscheibe des Autos bis zur ständig in Marys Gesichtsfeld auftauchenden Instanz seine Wirkung nicht verfehlt.
Ich weiß nicht, ob die Frage jemals abschließend geklärt werden kann, und wahrscheinlich ist CARNIVAL OF SOULS nicht der erste Film überhaupt, der sich des „Surprise! You’re dead!“-Twists bedient, aber es ist fraglos einer der ersten, der dieses – heutzutage leider zum absoluten Klischee verkommene – Gimmick effektiv verwendet. Mit Hindsight 20/20 aus dem Jahr 2019 ist der Twist natürlich vorhersehbar, aber 1962 sollte er eigentlich gezündet haben, wobei der Film erfreulich ambivalent bleibt, was die Frage angeht, ob der ganze Film nun nur eine Halluzination der sterbenden Mary war (und der Film damit der direkte Ahnherr von JACOBS’S LADDER) oder die Ereignisse sich „tatsächlich“ abgespielt haben (wofür spricht, dass wir, bevor der Twist vollzogen wird, den Mini-Epilog mit Samuels und dem Priester am See haben, die über den Vorfall sinnieren, was ja nur Sinn macht, wenn sie wirklich existente Personen sind), der Film also dann eine ganz andere Kategorie „Übernatürliches“ eröffnen würde (mal ganz abgesehen davon, dass der Film uns wie eine Matroschka-Puppe Visionen innerhalb von Visionen innerhalb von Visionen serviert). Es ist dabei auch gar nicht so verkehrt, dass Mary keine klassische B-Horror-Heroine ist – sie ist schroff, abweisend (aber easy on the eyes, ehm), keine besonders liebenswerte Person ohne soziale Bindungen (wobei die Frage bleibt, ob das nur die Post-Unfall-Mary ist – vor dem Unfall hat sie ja immerhin mindestens zwei Freundinnen gehabt). Die Auswahl muss in Salt Lake City nicht besonders groß sein, wenn John Linden so hartnäckig am Baggern ist, obwohl Mary nun wirklich alles andere als einladende Signale sendet (aber es ist halt Mormonen-Country, da muss mann vielleicht wirklich nehmen, was man kriegt, ähm).
Wie gesagt, technisch lässt Harvey mit seiner Routine nichts anbrennen – die teilweise im guerilla-style geschossenen Stadt-Aufnahmen stilisieren Mary gekonnt zu einem Fremdkörper (auch der Kniff, dass die stumm gedrehten Aufnahmen leicht beschleunigt abgespielt werden, trägt zu diesem Eindruck bei), und die Sequenzen, in denen Mary, angekündigt durch den Waber-Effekt, aus der „Realität“ ausgeblendet wird, sind, obwohl ohne jegliche technische Mätzchen bis auf das Herunterdrehen der Geräusch-Tonspur, allemal wirkungsvoll. Natürlich zieht Harvey auch großen Nutzen aus der Location des verlassenen Rummels und Harveys Stamm-Kameramann Maurice Prather, der auch selbst Dokumentationen und Industriefilme drehte, und für den CARNIVAL OF SOULS auch der einzige Ausflug ins Erzählkino bleiben sollte, schafft in diesen Sequenzen auch eine angemessene Schaueratmosphäre, die sich reizvoll von den wie gesagt sachlichen, beinahe semidokumentarischen Stadtaufnahmen absetzt. Man darf ein wenig trauern, dass dieses talentierte Team nicht mehr Gelegenheit erhielt, sich im phantastischen Genre zu versuchen.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss des Orgel-Scores und seiner seltsamen, „eerie“ Themen (die dann auch den Pastor so verstören) und zum „außerweltlichen“, TWILIGHT-ZONE-esken Feeling des Films beitragen. Da fehlt dann nur noch Rod Serling, dessen Erzählerstimme bedeutungsschwanger von kommendem Unheil berichtet.
Wie gesagt – echte Horror-Momente gibt’s kaum. CARNIVAL OF SOULS will nur durch Stimmung, durch Atmosphäre, durch creepyness fesseln – das leicht zombifizierte Make-up des Ghoul ist in der Tat das „Schrecklichste“, was der Film zu bieten hat (knapp gefolgt von der untoten Ausgabe Marys im Finale), wohingegen für die meisten anderen Untoten nur ganz schlichtes Make-up (weißgeschminkte Gesichter und schwarz umrandete Augen… sehen ein bisschen aus wie Pandas, die Armen) aufgewendet wurde. Dennoch scheint die direkte Verbindung von Harveys zentralem Ghoul zu den NOTLD-Zombies nicht wegzudiskutieren zu sein.
Die schauspielerischen Leistungen sind okay – Candace Hilligoss hat einen, wie gesagt, nicht ganz einfachen Charakter zu spielen. Wir sollen Mary nicht unbedingt mögen, sondern sie schon für eine wunderliche Person halten, andererseits soll uns ihr Schicksal natürlich auch nicht ganz am Allerwertesten vorbeigehen, und diesen Balanceakt bekommt Hilligoss ziemlich gut hin für jemanden, der zum ersten Mal in einer Hauptrolle vor der Kamera steht. Auch die weiteren Darsteller, überwiegend Laiendarsteller, die Harvey vor Ort rekrutierte, machen sich in diesem Rahmen ordentlich – Sidney Berger ist ein angemessen wieselig-schleimiger John Linden, Art Ellison und Stan Levitt sind als Priester bzw. Samuels ebenfalls brauchbar. Der Regisseur selbst ist ein durchaus kompetenter Boogeyman… Ein bisschen durch den Rost fällt höchstens Frances Feist als ältliche Vermieterin.
CARNIVAL OF SOULS firmierte in Teutonien früher als TANZ DER TOTEN SEELEN (keine schlechte Eindeutschung), ist mittlerweile aber unter dem Originaltitel als Doppel-DVD von Best Entertainment (seufz) erhältlich, die sowohl die Kinofassung mit 75 Minuten Laufzeit als auch einen 78-minütigen Director’s Cut (mit ein paar Dialogszenen mehr) beinhaltet. Die Bildqualität ist angemessen (Best hat sich hier wohl des Criterion-Masters bedient), als Extras gibt’s u.a. einen Audiokommentar sowie ein gutes Stündchen von Harvey-Industriefilmen. Leider weigerte sich mein DVD-Player, die DVD des Director’s Cut (und mit den Industriefilm-Boni) länger als knapp 65 Minuten abzuspielen (und mein PC-Laufwerk verweigerte gleich beide Scheiben vollständig).
Summa summarum – CARNIVAL OF SOULS ist nicht der Film, den man einlegen sollte, wenn man sich mal wieder so richtig erschrecken lassen will, es ist ein sanfter Chiller, der schleichend unter die Haut geht, aber auch nach über fünfzig Jahren noch gut funktioniert, wenn man sich auf seinen TWILIGHT-ZONEigen Ansatz einlässt, Bilder und Klänge auf sich wirken lässt. Auch nicht der ideale Film zum Nebenbeikucken, weil die Wirkung des Films maßgeblich davon abhängt, dass man sich in seine Atmosphäre versenkt. Dann aber ist es eine lohnende Gänsehaut-Erfahrung…
© 2019 Dr. Acula
BOMBEN-Skala: 4
BIER-Skala: 6
Review verfasst am: 05.11.2019

